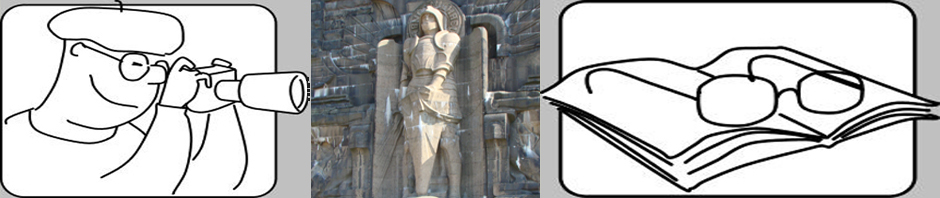Schnee auf dem Balkon
von Bernd Mai
Das russische Hoch hat erst den Schnee und dann die Kälte gebracht. Die Balkonbrüstungen tragen lustige weiße Hauben. Wenn sich ein Vogel auf einer Brüstung niederläßt, stiebt der trockene Schnee in einer kleinen Wolke auf, und der Vogel hinterläßt eine deutliche Spur. Antons Balkon zeigt nach Norden, und die Sonne bescheint ihn nur in den frühen Morgenstunden. Darüber kann man denken wie man will, Anton aber ist deshalb nicht böse. Er bedauert die Bewohner des gegenüberliegenden Blocks, der einer Genossenschaft gehört. Ihnen scheint die Sonne fast den ganzen Tag auf Wände und Fenster, und Anton kennt die Auswirkungen. Er beobachtet ihre Bemühungen, sommers die Temperatur in ihren Wohnungen durch große Markisen in erträglichen Grenzen zu halten, mit belustigtem und mitleidigem Lächeln. Aber jetzt ist es Winter. Und Antons Balkon ist über und über mit Pulverschnee bedeckt. Würde die Februarsonne darauf scheinen, könnte er ihn glitzern sehen. Nach und nach haben die Sperlinge, Amseln und Meisen ihre Spuren auf der Betonbrüstung hinterlassen, und mancher der Vögel hat sich in der Hoffnung auf etwas Freßbares auf den Boden gewagt. Ihre Spuren bedecken kreuz und quer den Balkon. Wenn Anton morgens in die Küche kommt, um sein Frühstück zu bereiten, schaut er kurz durch die Balkontür, und er freut sich, wenn er neue Spuren entdeckt. Er denkt darüber nach, die Entwicklung mit einer Fotoserie zu dokumentieren, aber dazu müßte er auf den Balkon hinaustreten, und er würde das Bild zwangsläufig zerstören.
Die Kälteperiode geht in die zweite Woche. Die Temperaturen fallen nachts unter fünfzehn Grad minus, und auch am Tage wird es nicht wärmer als zehn Grad minus. In Antons Wohnung aber ist es gemütlich warm, die Fernheizung funktioniert tadellos, und sein Auto springt zuverlässig an, wenn er zu Bettina ins Anhaltische fährt. Aber heute muß Anton nirgendwo hin. Sein Kühlschrank ist gut gefüllt, und sein Getränkevorrat ausreichend. Er kommt aus dem Badezimmer in die Küche, und er schaltet den Herd für das Frühstücksei und den Wasserkocher für den Guten-Morgen-Tee ein. Sein Blick fällt wie immer kurz durch die Glasscheibe der Balkontür. Anton stutzt. Er geht dicht an die Tür und schaut noch einmal auf den Balkon. Im morgendlichen Dämmerlicht sind deutlich menschliche Fußspuren zu sehen. Sie verlaufen von rechts nach links quer über seinen Balkon, und die Abdrücke der beschuhten Füße zeichnen sich klar und deutlich im Schnee ab. Anton ist ratlos. Von rechts nach links. Aber rechts ist nichts. Links ist der Balkon seines schwulen Nachbarn. Der Schnee auf der Brüstung zum Nachbarn hinüber ist unberührt. Anton zieht sich an. Er kommt zurück in die Küche und schaltet Herd und Wasserkocher wieder aus. Dann öffnet er die Balkontür und tritt hinaus in die Kälte. Kein Zweifel, die Spur ist immer noch da. Es sind die Fußabdrücke eines Mannes, und sie sind ungefähr so groß wie Antons eigene Spuren. Sie beginnen abrupt auf der rechten Seite um ebenso abrupt auf der linken zu enden. Antons Verwirrung steigt. Er geht wieder hinein, und er beschließt, die Erscheinung einfach zu ignorieren. Das kann nur eine Erscheinung sein, denkt er. Die letzte Erscheinung hat er vor zwanzig Jahren gehabt. Aber da hatte ihn seine Frau verlassen, und Anton ist sturzbetrunken gewesen. In Gedanken überprüft er seinen gestrigen Getränkekonsum. Ein Bier zum Abendbrot, dann noch eins und einen Doppelkorn. Dann hatte er sich die Quizshow angesehen. Aus Ärger über den schlechten Kandidaten hatte er noch einen Doppelkorn genommen. Nach der Show hatten sie auf ARTE „Ein Mann und eine Frau“ von Claude Lelouch gezeigt. Anton hatte den melancholischen Film mit zwei Gläsern Wein gefeiert. Alles in allem also nichts Besonderes. Er öffnet den Kühlschrank und überprüft die Pegelstände der betreffenden Flaschen. Sie sehen exakt so aus, wie er sie am Abend zuvor hineingestellt hatte.
Anton bereitet geistesabwesend sein Frühstück. Das Ei wird viel zu hart, und das Eigelb ist blau angelaufen. Der Toast verbrennt. Er gießt den Tee mit kaltem Wasser auf. In Antons Kopf herrscht Leere. Als Kind ist er geschlafwandelt, das weiß er noch. Die elterliche Wohnung hatte man zwischen den Kriegen von einer herrschaftlichen Beletagewohnung abgetrennt. Als sie einzogen, waren neben den Türen des Schlafzimmers und des Wohnzimmers noch die Klingelknöpfe zum Rufen der Dienstboten angebracht gewesen, und das Kinderzimmer, das sich Anton mit seinem Bruder teilte, hatte einst die Köchin bewohnt. Das wußten sie von ihren Nachbarn, zwei ältlichen Fräuleins, die Schwestern waren und Carlsohn – mit „h“ – hießen. Die ältere der Schwestern war Buchhändlerin und arbeitete in der Universitätsbuchhandlung. Anton hatte die Buchhandlung als Jugendlicher neugierig aufgesucht, weil er gehofft hatte, durch die Bekanntschaft mit Fräulein Carlsohn, der Älteren, leichter an Bücher von Dürrenmatt und Böll zu kommen. Enttäuscht war er wieder abgezogen. In dieser Buchhandlung gäbe es keine Belletristik, hatte man ihm stirnrunzelnd erklärt. Das Jüngere der Fräuleins war Damenschneiderin – selbständige Damenschneidermeisterin – und sie hatte ein kreisrundes Schildchen von der Größe eines Bierdeckels an ihre Wohnungstür geheftet, das die Insignien der Damenschneiderinnung zeigte. Die Nachbarwohnung war doppelt so groß wie die von Antons Eltern, und die wirklich vornehmen Räume, das getäfelte Eßzimmer, die großbürgerliche Küche, das Herrenzimmer – ebenfalls getäfelt – und der Salon, befanden sich auf der Seite der Nachbarinnen, die schon als Kinder dort gelebt hatten. Die Jüngere war die elegante Frau von Welt, und die Ältere das graue Mäuschen. Der Jüngeren gehörte ein riesiger schwarz-weißer Kater, der das Benehmen eines Snobs hatte. Anton erinnert sich daran, wie die Schneiderin in ihrer geöffneten Wohnungstür stand, um mit seiner Mutter zu schwatzen. Der Kater, er hieß Napoleon, saß immer zu ihren Füßen, um nichts zu verpassen. Die Schneiderin hatte stets ein Metermaß wie ein Ehrenabzeichen um den Nacken hängen, und sie stützte die rechte Hand in die üppige Hüfte. In der linken Hand balancierte sie eine Zigarettenspitze, in der eine „Carmen“ qualmte. Lässig wechselte sie Standbein und Spielbein. Ihre Kundinnen, meist Turniertänzerinnen, versorgten sie mit den begehrten West-Zigaretten der Marken „HB“, „Lux“ und „Peter Stuyvesand“, aber am liebsten rauchte sie „Carmen“ ohne Filter. Sie qualmte wie ein Schlot, und ihre Stimme hatte einen rauhen und hocherotischen Klang. Aber das mit der Erotik verstand Anton damals noch nicht. Als reifer Mann hätte er sie wohl recht attraktiv gefunden in ihrer blonden Üppigkeit. Einmal, Anton war als Soldat auf Urlaub zu Hause und seine Eltern waren irgendwie gerade abwesend, luden die Fräuleins ihn zum Mittagessen ein. Sie führten ihn in ihren Salon, wo der Tisch gedeckt war. Das wertvolle Porzellan schimmerte matt, und Anton widerstand der Versuchung, den Teller herumzudrehen, um nach der Marke zu schauen. Die gestärkten schneeweißen Servietten steckten in silbernen Serviettenringen, am Silberbesteck entdeckte Anton dezente Jugendstilverzierungen, und er hatte Angst, etwas kaputt zu machen. Es gab Pellkartoffeln mit Quark …
Die Wohnung von Antons Eltern war zwar der bescheidenere und kleinere Teil der Beletagewohnung, aber sie war immer noch größer als die Hinterhofwohnungen der meisten seiner Schulkameraden. Nachts war er hin und wieder erwacht, während er im langen und dunklen Korridor das Licht einzuschalten versuchte. Verwirrt stand er neben der Küchentür, und überlegte, was er hier zu suchen haben könnte. Dann ging er verängstigt wieder ins Bett. Sollte er auch heute Nacht gewandelt sein? Auf dem Balkon? Von rechts nach links? Dann hätten aber die Spuren im Schnee nicht unvermittelt rechts beginnen dürfen. Dann hätten sie auch vor der Balkontür sein müssen. Aber da sind keine. Anton geht ins Schlafzimmer. Er will sein Bett machen. Er schüttelt das Kopfkissen auf, greift nach der Steppdecke, legt sie wieder hin. Dann geht er ins Wohnzimmer. Auf dem Tisch steht noch das leere Narsanglas. Er nimmt es, und will es in die Küche bringen. Er stellt es auf der Flurgarderobe ab und starrt in den Spiegel. Ein verwirrter alter Kerl guckt ihn an, er müßte wieder einmal zum Friseur gehen. Anton beschließt zu handeln. Er holt den Besen aus der Ecke und greift sich die Müllschippe und den Handfeger. Dann zieht er ein Paar Schuhe an und geht entschlossen auf den Balkon. Zuerst fegt er die Brüstung ab. Dann kehrt er den lockeren Schnee zu einem Haufen zusammen. Er nimmt mit der Schippe den Schnee auf und wirft ihn über die Balkonbrüstung nach unten auf den breiten Rasenstreifen zwischen Haus und Fußweg. Schippe für Schippe. Wenn der Schnee unten ankommt, macht es dumpf „plopp“. Das Meiste jedoch verweht beim Herunterfallen. Er wünscht sich, er hätte Handschuhe angezogen. Aber jetzt ist er fertig, und der Balkon ist sauber als wäre nichts gewesen.
Anton macht sich einen Tee und setzt sich an seinen Computer. Er will weiter am Schema der Ahnentafel arbeiten. Vor ihm auf dem Tisch liegt ein Haufen Zettel mit ungeordneten Notizen. Dies und das müßte er noch einmal genauer untersuchen, aber um in der Verwandtschaft herumzutelefonieren, ist es zu früh. Also ordnet er die Notizen, macht sich eine Liste mit notwendigen Schritten und trägt schon mal einige Geburts- und Sterbedaten seiner Vorfahren in das Schema ein. Die Arbeit nimmt ihn sehr in Anspruch. Bis auf eine kurze Mittagspause arbeitet er bis siebzehn Uhr durch. Dann ruft er noch einmal Cousine Thea an. Von ihr bekommt er die Telefonnummer von Cousin Alfred. Der ist schon in den fünfziger Jahren „in den Westen gemacht“, und Anton hat ihn nie kennengelernt. Ab und zu hatten seine Mutter und die Chemnitzer Tanten von Alfred gesprochen. Er hätte in der Großindustrie Karriere gemacht, hieß es immer. Als er Cousine Thea danach fragt, lacht sie, nein, nicht in der Großindustrie, er sei bis zu seiner Pensionierung Braumeister in einer Privatbrauerei in Franken gewesen. Die Gedanken an die Fußspuren auf dem Balkon verblassen. Es wird neunzehn Uhr, und Anton will aufhören. Er sammelt die Blätter mit den Notizen, die verstreut seinen Tisch bedecken, zusammen. Dazwischen liegt der Brief von Cousine Thea, Anton hat ihn noch nicht geöffnet, und er hätte ihn beinahe vergessen. Er schlitzt ihn mit seinem Opinel-Messer auf, und es fallen ein paar Blätter heraus.
Es sind Kopien von alten Schwarz-Weiß-Fotos auf normalem Papier und eine kurze Notiz von Thea. Die Kopien sind schlecht, aber man kann die abgebildeten Personen einigermaßen gut erkennen. Anton schüttelt den Kopf. Der Gattin eines wohlhabenden Steuerberaters aus dem Schwäbischen hätte er mehr Sorgfalt und einen besseren Kopierer zugetraut. Einige der Fotos kennt er bereits aus dem Fotoalbum seiner Mutter. Sie zeigen seine Großmutter väterlicherseits wie auf einem Bild von Dürer in verschiedenen Altersstufen. Seine Oma als junges Mädchen – das kennt er noch nicht! Es ist ein Doppelporträt, und neben dem Bild der Oma ist ein junger Mann auf einem zweiten Foto abgebildet. Er trägt den Rock des Kaisers, muß also ungefähr zwanzig Jahre alt sein. Kein Zweifel, das ist sein Großvater Emil. Anton denkt, daß man solche Bilder mit der Liebsten machen ließ, wenn man zum Wehrdienst eingezogen wurde, die Wehrpflicht dauerte immerhin zwei Jahre. Es findet ein weiteres Bild seines Großvaters. Auf dem ist er etwa fünfzig, und er wirkt ein wenig füllig. Auch das kennt Anton noch nicht. Es ist ein Brustbild, und man kann nicht sehen, daß der linke Arm fehlt. Der Großvater hat ihn 1917 in Frankreich verloren. Auf dem Foto trägt er Arbeitsdrillich und ein gestreiftes kragenloses Hemd, dessen oberster Knopf akkurat geschlossen ist. Aus der Brusttasche der Jacke schaut ein Bleistift hervor. Er hat die gleichen hängenden Augenlider wie Anton, die gleiche markante Nase und die gleiche hohe Stirn. Es ist ein professionelles Porträt, und Anton überlegt, zu welchem Anlaß es gemacht wurde. Zu jener Zeit nahm man es mit der Kleiderordnung und dem „anständigen Anzug“ sehr genau. Ein Porträt in Arbeitskleidung? Zu welchem Zweck? Für den „Vorwärts“? Aber den gab es ab 1933 nicht mehr. Es gibt ein Porträt von Anton, auf dem er ebenfalls einen Arbeitsanzug trägt. Es wurde vom Betriebsfotografen gemacht und erschien in der „Roten Zahnflanke“, der Betriebszeitung, anläßlich der Inbetriebnahme eines Zahnradprüfgerätes der Firma „Carl Zeiss Jena“. Die Auto-Union hatte in den dreißiger Jahren über 20.000 Angestellte, und vielleicht gab es zu jener Zeit auch so etwas wie eine „Betriebszeitung“? Der Großvater schaut den Betrachter ernst und selbstbewußt an. Anton kennt diese Sorte Männer, Adel im Blaumann. Er ist ihnen in den verschiedenen Werkstätten und Werkhallen seiner jungen Jahre begegnet, und er hat immer großen Respekt vor ihnen gehabt. Anton bedauert, seinen Opa nie kennengelernt zu haben. Er ist ein paar Tage nach Antons Geburt gestorben.
Das nächste Bild zeigt eine fröhliche Feiergesellschaft, und die Abgebildeten wirken gar nicht steif und verklemmt wie auf den meisten Fotos aus jener Zeit. Das Bild entstand 1929, und es wurde während des Polterabends seiner Tante Friedel aufgenommen. Rechts, sitzend, sind die Großeltern zu sehen, der Opa hält ein gefülltes Weinglas in der rechten Hand, wo sonst, er hatte keine linke mehr. Links sitzen seine Tante Frieda und Onkel Erich, das Polterpaar, sie sind mit Blumen bekränzt. Frühe Hippies, denkt Anton, und er grinst. Die Großeltern sind die einzigen, die ernst schauen. Die Oma hat die Hände verschränkt in den Schoß gelegt, und sie schaut ein wenig besorgt. Alle anderen lachen oder lächeln wenigstens fröhlich, außer Tante Gretel, die lächelt eher verkniffen und ein wenig betreten. Aber sie ist immer ein bißchen etepetete gewesen. Die Onkel und Tanten findet Anton sofort, die anderen Personen kennt er nicht, es sind Verwandte seines Onkels Erich, der Klarinettist im Stadttheater Chemnitz gewesen ist. In der zweiten Reihe, stehend, erkennt er seinen Vater Hans. So jung hat Anton ihn noch nie gesehen, außer auf den Fotos, die ihn als Knaben zeigen. Und auf denen sieht er stets so aus, als hätte er ein schlechtes Gewissen oder als hätte er gerade eine Ohrfeige bekommen. Auch er lächelt, aber sein Lächeln wirkt verlegen. Rechts neben ihm steht ein hübsche junge Frau. Ihre Schultern berühren sich, und sie hat sich bei seinem Vater eingehakt. Die Körpersprache ist eindeutig. Sie ist eine knuddelige kleine Person mit dunklem Haaren, und Anton glaubt auf dem Schwarz-Weiß-Foto ihre braunen Augen glänzen zu sehen. Ihr voller sinnlicher Mund ist halb geöffnet, als sagte sie gerade etwas. Als junger Mann hat Anton eine Schwäche für diesen Typ gehabt, und Bettina sieht auf alten Fotos ganz ähnlich aus. Das sei das Elsel, die erste Frau seines Vaters, hat Cousine Thea gesagt. Mit ihr hatte er einen Sohn gehabt, um den er sich nach der Scheidung nicht mehr kümmerte. Anton hat im Internet nach seinem Halbbruder gesucht. Auf einer Seite, die sich „Virtueller Grabstein“ nennt, hat er ihn gefunden.
Anton ist müde, und er räumt die Papiere weg. Er holt die angebrochene Flasche Wein aus dem Kühlschrank und gießt sich ein Glas ein. Dann chattet er ein wenig mit Ina, seiner norddeutschen Tickerfreundin. Aber auch Ina hat Sorgen, und das Gespräch will nicht richtig in Gang kommen. Anton verabschiedet sich. Auf 3sat läuft „Die Dinge des Lebens“ von Claude Sautet mit Romy Schneider und Michel Piccoli. Als der Film zu Ende ist, ist auch der Wein ausgetrunken, und Anton geht ins Bett.
Ein kleines Tief hat sich durch die stabile russische Hochdruckwetterlage gemogelt. Die Temperaturen sind auf vier Grad minus gestiegen und es gibt Neuschnee. Anton erwacht, weil er Harndrang verspürt. Er geht auf die Toilette und dann in die Küche, um ein Glas Wasser zu trinken. Er schaut durch die Glastür auf seinen Balkon. Der Boden ist erneut mit einer dünnen und makellosen Schneeschicht bedeckt. Es ist halb drei und Anton geht wieder ins Bett. Es dauert einige Zeit, bis er einschläft, und sein Schlaf ist flach und unruhig. Er hat merkwürdige Traumgesichte, an die er sich nicht mehr erinnert, kaum daß er wach wird. Und er wird noch drei Mal wach, bevor er gegen halb sieben beschließt aufzustehen.
Anton geht in die Küche um sein Frühstück zuzubereiten. Er verrichtet mechanisch die gewohnten Handgriffe, und er vermeidet es, auf den Balkon zu schauen. Dann setzt er sich an den Tisch. Jetzt kann er nicht mehr anders, er sitzt neben dem Fenster, und er dreht den Kopf. Als seine Augen sich an das Dämmerlicht draußen gewöhnt haben, erkennt er die Spuren auf dem Balkon. Sie verlaufen wieder von rechts nach links. Anton öffnet die Tür und schaut sie sich genauer an. Es sind zweifellos die Spuren von Frauenschuhen. Sie sind kleiner als gestern, und er kann deutlich den kleinen Absatz von der größeren vorderen Halbsohle unterscheiden. Die Abstände zwischen den Fußtritten sind kleiner als gestern. Solche Spuren machte früher seine Mutter in den Schnee. Das weiß er noch. Sie trug meist Schuhe mit mäßig hohen Absätze, und sie litt unter Hühneraugen. Mit der Zeit entstanden neben den kleinen Zehen große Ausbeulungen an beiden Schuhen eines Paares, die Anton immer mit Respekt und Bewunderung begutachtet hatte. So etwas hatte nur seine Mutter, sonst niemand, den er kannte. Anton beschließt, das „Phänomen“, so nennt er es, zu ignorieren. Nach seinem Weltverständnis gibt es keine „Phänomene“ wie das da! Und heute hat er keine Zeit für irgendwelche Faxen und „Phänomene“. Er ist bei seinem Endokrinologen angemeldet, um sich seine monatliche Hormonspritze abzuholen. Er geht ins Bad, um sich gründlich zu waschen. Dann zieht er frische Unterwäsche an. Er hüllt sich gegen die Kälte in mehrere dünne Kleidungsstücke und zieht zum Schluß die Strickjacke, ein Geschenk Bettinas, über.
Die Praxis ist voll. Er möge bitte Platz nehmen, sagt die Schwester am Empfang, und Anton setzt sich auf den letzten freien Stuhl. Ihm gegenüber, auf einer Art Chaiselongue, sitzen eine junge Mutter mit ihrem Kleinkind und die Oma des Kindes. Die Oma hat eine flache Nase und hohe Wangenknochen, und sie ist nie wirklich schön gewesen, aber ihr Gesicht drückt sanfte Zärtlichkeit aus. Ihre Brüste sind groß und ihre Hüften breit, und die Proportionen stimmen. Anton ist beeindruckt. Die Familie okkupiert mit ihren Kleidungsstücken, zwei Rucksäcken, einem Korb voller Spielzeug und einem prall gefüllten Plastikbeutel die Bank, auf der gut sechs Leute Platz finden würden. In dem Beutel befinden sich Kekse und Süßigkeiten und eine Trinkflasche, um das Kind bei Laune halten zu können. Anton hat seine Jacke in die Garderobe gehängt, und er hat den Reißverschluß der Strickjacke geöffnet. Im Wartezimmer ist es warm und stickig und die Luft ist trocken. Er bekommt nach wenigen Minuten Durst und holt sich einen Becher Wasser aus dem Spender. In dem durchsichtigen Wassertank bildet sich ein Strudel und im Tank gurgelt es dumpf und bedrohlich. Das Kind steht neben ihm und schaut mit großen Augen und offenem Mund zu, wie er das Wasser in den Becher laufen läßt. Dann versucht es selbst, sich einen Becher aus der Halterung zu ziehen. Aber der Becher ist widerspenstig, und das Kind beginnt zu krakeelen. Die Oma springt mit einer Behendigkeit, die man ihr nicht zugetraut hätte, hinzu und versucht, das Kind von seinem Vorhaben abzubringen. Aber das Kind krakeelt noch lauter, und die Oma ändert ihre Taktik. Sie zieht einen Becher aus der Halterung, füllt ihn mit Wasser und hält ihn dem Kind an den Mund. Aber es schmeckt dem Kind nicht, und es spuckt das Wasser auf den Boden. Die Oma holt aus dem Funktionsraum ein Stück Zellstoff und wischt das kleine Malheur weg. Dann gibt sie dem Kind aus seiner Babyflasche zu trinken. Das Kind nuckelt gierig. Die Flüssigkeit in der Flasche sieht gefährlich pink aus. Die Mutter des Kindes, eine dicke junge Frau, sitzt gelangweilt und teilnahmslos da und zollt der Szene kaum Beachtung. Die Oma nimmt das Kind auf den Arm und setzt sich wieder Anton gegenüber. Sie lächelt ihn verschämt an. Anton lächelt, so breit er kann, zurück. Das Kind ist müde. Es kuschelt sich an die Oma, wobei es mit seinen kleinen Fäusten an ihrem Ausschnitt zerrt. Ein rosa Träger des Büstenhalters wird sichtbar. Die Oma achtet nicht darauf. Sie herzt das Kind nach der Schnur und flüstert ihm Zärtlichkeiten ins Ohr. Das Kind steckt den Daumen in den Mund und schließt die Augen. Anton betrachtet die Oma genauer. Sie fühlt seinen Blick und lächelt ihn wieder an, und Anton lächelt gewinnend zurück. Er läßt seinen Blick auf ihrem Ausschnitt ruhen. Sie schiebt die Zungenspitze ein wenig durch die halb geöffneten Lippen und streicht mit der Zunge flink ein paarmal über die Lippen. Jetzt glänzen sie, und Anton grinst sie offen an. Sie schaut verstohlen zu ihrer Tochter. Aber die bekommt von all dem nichts mit. Anton wird in den Funktionsraum gerufen. Er steht auf, schaut die Oma an und zieht bedauernd die Augenbrauen in die Höhe, die Oma guckt schamhaft zur Seite. Anton bekommt seine Spritze. Als er sich fertig angezogen hat und gehen will, schaut er noch einmal zu der Frau hinüber. Aber die ist ganz und gar mit dem Kind beschäftigt. Anton zuckt mit den Schultern und geht.
Anton will in sein Auto steigen, da klingelt das Handy. Es ist ein Hilferuf seiner Schwägerin. Sie will Fotos auf eine CD brennen, aber ihr Rechner verweigert den Dienst. Anton runzelt die Stirn. Er hat im Verlaufe vieler Stunden versucht, ihr das kleine Einmaleins des Computerns beizubringen. Sie ist siebzig und war Zeit ihres Arbeitslebens als Lehrerin tätig, genau wie Bettina. Anton hat in den achtziger Jahren Seminare gehalten, als sie ihre neuen rumänischen PDP-11-Clone mit COBOL programmieren wollten. Seine Schwägerin ist die ehrgeizigste Schülerin gewesen, die er je gehabt hat, aber die Sache mit dem CD-Brennen ist dann doch ein wenig heikel. Er verspricht ihr zu kommen, auf der Stelle, es passe gerade, und Anton fährt stadtauswärts Richtung Süden, vorbei am Völkerschlachtdenkmal und am Südfriedhof, wo jenseits der alten Stadtgrenze das kleine eingemeindete Dorf liegt, in dem sein Bruder und seine Frau sich ein Haus gebaut haben.
Als Anton nach Hause kommt, ist es bereits dunkel. Er hat zu Essen bekommen und man hat ihm eine Flasche Wein für seine Bemühungen geschenkt. Die Arbeit mit der Schwägerin hat ihn erschöpft, und er freut sich auf seine vier Wände und auf den Wein. Seinem Bruder und seiner Schwägerin hat er das „Phänomen“ verschwiegen. Er hat jeden Gedanken daran verdrängt, und Anton hat die Fußspuren auf seinem Balkon beinahe vergessen. Er geht in die Küche, um sich einen Grog zu machen und die Weinflasche zu öffnen. Während das Wasser im Kocher erhitzt wird, schaut er verloren durch die Scheibe der Balkontür. Nach einigen Augenblicken glaubt er seinen Augen nicht zu trauen. Neben der Frauenspur sind deutlich die Tritte eines Kindes zu erkennen. Auch sie verlaufen von rechts nach links, und es sieht aus, als wäre das Kind an der rechten Hand der Frau unterwegs gewesen. Es muß ein Kleinkind gewesen sein, so wie das Kind in der Praxis des Endokrinologen, und etwa in der Mitte des Balkons muß es gestolpert sein. Das sagt jedenfalls die Fährte im Schnee. Anton überlegt, wie dem „Phänomen“ auf die Spur zu kommen wäre. Er stellt den Grog fertig und macht ihn ein wenig steifer als gewöhnlich. Dann stellt er einen seiner bequemen Bauhaus-Stühle in Position. Er holt seine Kamera und stellt den „Night-Shot“-Modus ein. Dann öffnet er die Weinflasche, löscht das Licht und schaltet das Radio aus. Er hüllt sich in eine Wolldecke ein und setzt sich vor der Glastür des Balkons in Positur, die Kamera und die Gläser mit den Getränken auf dem Küchentisch in Reichweite.
Es ist still. Anton hört nur das Rauschen des Exhausters auf dem Dach. Die Maschine läuft seit zwanzig Jahren, und sie war in der ganzen Zeit nur zweimal für wenige Stunde außer Betrieb. Das Geräusch ist Bestandteil seines Lebens, und jedes Mal, wenn der Entlüfter zu Wartungszwecken abgeschaltet war, ist das ein ganz seltsamer Eindruck gewesen. Von der Hauptstraße her hört er eine Straßenbahn über eine Weiche rumpeln. Das wütende Gebell eines Hundes verstummt bald wieder. Vor dem Block schimpft eine Mutter mit ihrem Kind. Sie will nach Hause, und das Kind trödelt herum. Ein Auto will nicht anspringen. Der Fahrer gibt nach sechs oder sieben Versuchen endlich auf. Der junge Mann mit der Lautsprecherbox auf Rädern kommt nach Hause. Das Wumm-Wumm-Wumm der Bässe verstummt nach einer Minute. Jetzt wissen alle, daß er wieder da ist. Autotüren knallen. Die Fernheizung gibt ein leises Knattergeräusch von sich. Das Knattern geht in ein heimeliges Blubbern über, bevor das Geräusch verstummt. Antons Augen gewöhnen sich an das Dunkel. Er schlürft den heißen Grog in kleinen Schlucken, und ihm wird unter seiner Wolldecke warm. Er überprüft noch einmal die Einstellungen seiner Kamera. Dann lehnt er sich zurück. Im Block gegenüber sind viele Fenster erleuchtet, in den meisten sieht er den Fernsehapparat bläulich flimmern. Ob die modernen Flachbildgeräte auch das typische blaue Flimmern erzeugen? fragt sich Anton. Auf dem Balkon gegenüber steht eine Frau und raucht. Sie ist in einen dick gefütterten weißen Anorak gehüllt. Aber sie verschwindet bald wieder in der Wohnung, und Anton kann beobachten, wie sie vorher die Kippe achtlos auf den Fußweg wirft. Die Kippe beschreibt beim Herabfallen eine gekrümmte Feuerspur. Die Entfernung zwischen den Blöcken beträgt etwa sechzig Meter, und Anton steht auf, um sein Opernglas aus dem Wohnzimmer zu holen. Es ist ein Erbstück seiner Mutter. Es wurde in Rathenow gefertigt, und es ist ein ausgezeichnetes Opernglas. Sein Vater hatte es seiner Mutter zum fünfzigsten Geburtstag geschenkt. Antons Vater hatte selten Lust gehabt, seine Frau ins Theater zu begleiten. Weil sie aber ein Betriebsanrecht hatten, mußte Anton als junger Bursche zu den Vorstellungen mitkommen, damit die zweite Karte nicht verfiel. Anton kann sich daran erinnern, daß sie das Glas gern benutzt hatte, und nicht nur, um die Akteure auf der Bühne besser beobachten zu können. Seine Mutter hatte ganz besonders die Operette geliebt, und so hat Anton sich quer durch die europäische Operettenliteratur quälen müssen. Er war aber schon mit vierzehn Jahren ein geübter Leser gewesen, und mit fünfzehn hatte er sich bereits durch alle französischen und russischen Klassiker gearbeitet. Deshalb bereiteten ihm die kruden Fabeln der Operetten, aber auch der Opern, geradezu körperliche Qualen, und mit der Musik, zu der seine Mutter gern leise mitsummte, sie kannte alle populären Stücke, hatte er nie etwas anfangen können. In diesem Alter liebte Anton Dixielandmusik über alles, und wenn Kenny Ball zur Messe nach Leipzig kam, um mit seinen Jazzmen in der Kongreßhalle zu spielen, bettelte er seine Mutter so lange, bis sie ihm die paar Mark für die Eintrittskarte schenkte. Nur eine einzige, eine moderne sowjetische Operette hat sich in sein Gedächtnis gegraben. Sie sie hieß „Alle helfen Lidotschka“. Anton wußte damals nicht, daß die Musik vom großen Schostakowitsch und das deutsche Libretto vom Dichter Kuba persönlich gewesen sind.
Anton hüllt sich wieder in seine Decke. Der Grog ist ausgetrunken, und er gießt sich ein Glas Wein ein. Nach und nach erlöschen im Block gegenüber die Lichter. Hin und wieder tritt jemand auf den Balkon, um die Abendzigarette zu rauchen. Dann hebt Anton das Opernglas an die Augen und schaut neugierig hinüber. Ab und zu nippt er an seinem Wein. Er hat die Füße auf einen seiner Küchenstühle gelegt, und er ist ganz entspannt. Der Tag ist anstrengend gewesen, die Lider werden schwer. Anton starrt angespannt auf den Balkon. Die Kamera hat er sich um den Hals gehängt, um sie schnell parat zu haben, falls … Ja, falls was? Falls sich das „Phänomen“ zeigt? Manifestiert? Materialisiert? Anton weiß es nicht, aber er ist ganz gelassen. Er wird der Sache auf den Grund gehen. Da hört er auf dem Flur ein Geräusch. Es klingt wie die Schritte eines Kindes. Trap-trap-trap … Stille. Dann wieder: Trap-trap-trap. Die Schritte nähern sich der Küchentür. Anton wirft die Decke von sich und springt auf die Füße. Er reißt die Küchentür auf und schaltet das Licht ein. Aber da ist nichts. Er läuft durch den Flur und öffnet alle Türen. Toilette, Schlafzimmer, Wohnzimmer … nichts. Stille. Der Exhauster rauscht. Auf der Straße bellt ein verspäteter Hund. Die Heizung knistert. Anton beschließt, die Aktion abzubrechen. Er hat plötzlich Angst, den Verstand zu verlieren. Nachdem er alle Türen wieder geschlossen und die Wohnungstür kontrolliert hat, geht er zurück in die Küche.
Anton erstarrt. Draußen, vor der Balkontür, steht ein Kind. Es patscht mit seinen Händchen gegen die Glasscheibe. Papp-papp-papp. Es ist mit nichts anderem als einem Spielhöschen bekleidet. Der rechte Träger ist von der Schulter gerutscht. Es lacht Anton an und patscht wieder gegen die Scheibe. Im Hintergrund zeichnet sich der Umriß einer kleinen Frau ab. Sie lehnt an der Balkonbrüstung und hat die Arme unter der Brust verschränkt. Sie trägt ein blaues Samtkleid mit schwarzen Besätzen und um den Hals trägt sie eine Bernsteinkette. Die Bernsteinkugeln glitzern matt im Licht der Küchenlampe. Sie schaut Anton ausdruckslos an. Dann scheint es Anton, als verzöge sie den Mund zu einem winzigen Lächeln. Anton greift nach der Türverriegelung. „Wartet“, sagt er. „Ich komme!“
Leipzig und Wettin-Löbejün März 2012
© Bernd Mai