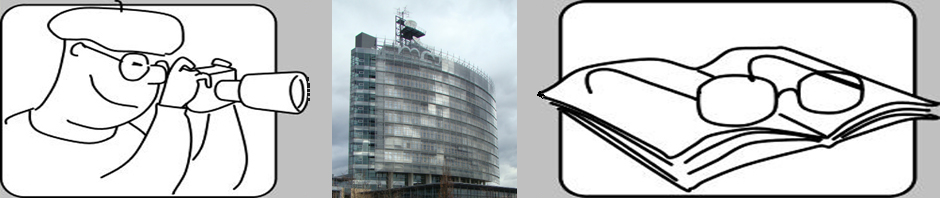Bindseil auf der Henrichshütte
von Bernd Mai
Mein Name ist Bindseil, Bodo Bindseil, und ich bin Privatdetektiv. Das klingt aufregender als es ist. Die meiste Zeit verbringe ich mit Klinkenputzen und Büroarbeit. Keine Keilereien, und geschossen und verfolgt wird auch nicht! Natürlich habe ich eine Pistole, eine russische Makarow, neun Millimeter, aber sie liegt in einem Stahlschrank in meinem Büro, und dort liegt sie gut. Mein Büro befindet sich im Souterrain einer Baugenossenschaft, und es ist winzig klein. Der Stahlschrank ist uralt, und an der Seite klebt noch das Inventarschild des VEB Leipziger Gummiwaren. Der Schrank und die anderen Möbel sind eine Leihgabe meines Vermieters, der Genossenschaft, ebenso das Telefon. Die Mitarbeiter des Hauses beobachten mein Treiben mit Mißtrauen, aber der Geschäftsführer hält seine schützende Hand über mich. Ich habe ihm einmal einen großen Gefallen getan. Um dem Getratsche der Mitarbeiter vorzubeugen, lasse ich meine Bürotür meistens offen. Ab und zu schaut jemand neugierig herein, wenn ich nicht da bin, und das entgeht mir natürlich nicht. Ich habe meine kleinen Tricks.
Es ist ein Wetter zum Weiterschlafen, aber ich habe Berichte zu schreiben, und ich komme um acht in mein Büro. Als ich die Tür öffne, rieche ich den Duft von Kaffee, Tabak und Parfüm. Hinter meinem Schreibtisch sitzt eine Dame auf dem wackligen Chefsessel. Sie ist aus den besten Jahren heraus, aber sie hält sich gut, und sie hat eine tüchtige Kosmetikerin. Sie trägt ein graues Business-Kostüm, aus dem Ausschnitt der Jacke schaut ein eisblaues Halstuch hervor, und sie raucht ein dünnes Zigarillo und schlürft Kaffee aus einem Becher mit dem Logo der Genossenschaft. Die Asche verstreut sie auf dem Fußboden, und sie lächelt mich an.
„Guten Morgen“, sage ich und hänge meine Jacke an den Garderobenständer.
„Ihre Damen haben mir freundlicherweise einen Kaffee gekocht.“ Sie klopft mit dem Zeigefinger auf ihr Zigarillo und verstreut noch mehr Asche. „Die waren ganz schön neugierig.“
„Das sind nicht meine Damen.“ Ich stelle ihr einen Aschenbecher hin.
Ich überlege, wie ich sie auf die andere Seite des Schreibtischs dirigieren kann, ohne unhöflich zu wirken, da steht sie auf, geht um den Schreibtisch herum und setzt sich auf den Besucherstuhl, das einzige anständige Möbel in meinem Büro. Sie schlägt die Beine übereinander, und ich versuche, nicht hinzuschauen. Während sie sich auf dem Stuhl lümmelt und mich abschätzend fixiert, zwänge ich mich zwischen Aktenschrank und Schreibtisch hindurch und setze mich.
„Was kann ich für Sie tun?“
Sie schaut sich im Büro um und verzieht den Mund.
„Bringt wohl nicht viel ein?“ Sie macht mit der Zigarillohand eine Bewegung, die das armselige Ambiente des Büros umschreibt.
„Also, was wollen Sie?“
„Finden Sie meinen Mann.“ Sie nimmt aus ihrer Barbara-Bui-Tasche einen DIN-A-5-Briefumschlag und wirft ihn auf den Schreibtisch.
„Wieso gehen Sie nicht zur Polizei? Die sind in diesen Dingen viel besser organisiert als ich.“
„Das geht Sie gar nichts an. Finden Sie ihn und fertig.“ Sie lächelt honigsüß.
„Sechzig Euro netto pro Stunde plus Spesen und dreihundert Vorschuß“, höre ich mich sagen, und ich ärgere mich, daß ich nicht achtzig und fünfhundert gesagt habe. Für gewöhnlich nehme ich fünfunddreißig pro Stunde. Sie nickt. In dem Umschlag wäre alles drin, was ich bräuchte, sagt sie und will gehen. Ich halte sie zurück, fülle ein Vertragsformular aus und lasse sie unterschreiben. Sie runzelt die Stirn.
„Ciao, Honey“, sagt sie und geht.
Ich nehme Handfeger und Kehrschaufel und entferne die Asche vom Fußboden. Dann öffne ich das Fenster, um zu lüften.
Ich untersuche den Inhalt des Briefumschlages. Er enthält ein paar 100-Euro-Scheine, einen Zettel mit den Personalien des abgängigen Gatten und ein Foto. Ich pfeife leise durch die Zähne. Der Mann ist wenigstens zwanzig Jahre jünger als Madame, und er sieht unverschämt gut aus. Aber da ist noch etwas in dem Umschlag – ein Bierdeckel. Ein ganz gewöhnlicher Bierdeckel der Krostitzer Brauerei. Auf der Rückseite hat jemand eine Notiz hinterlassen. „Hattingen Henrichshütte“ steht da. Dann trage ich den Vorschuß säuberlich in mein Kassenbuch ein und mache mich an meine Routinearbeiten.
Gegen drei bin ich mit allem fertig. Ich tüte die Berichte ein und adressiere die Umschläge. Dann widme ich mich dem neuen Fall. Hattingen ist eine Kleinstadt in NRW, aha, im Ruhrgebiet. Sie liegt direkt an der Ruhr, sehe ich, und da fällt mir etwas ein. Ich rufe Gerd an. Gerd ist ein Kollege aus Wuppertal, und wir haben einmal am Fall des verschwundenen Pudels zusammengearbeitet. Den Pudel haben wir nicht wiedergefunden, dafür aber das tote Mädchen aus der Ruhr. Es war eine traurige Geschichte. Ich erkläre ihm die Umstände.
„Hattingen“, sagt er, „na ja, nichts besonderes. Eine Industriestadt, wie es hier viele gibt. So was habt Ihr im Osten gar nicht. Großes Stahlwerk, die Henrichshütte. Aber das wurde Ende der achtziger Jahre geschlossen. Die Leute haben gekämpft, aber es hat nichts genützt. Im Jahre 2000 haben sie auf dem Gelände ein Museum für die Geschichte des Eisenhüttenwesens eröffnet.“
„Und?“ frage ich, „interessant?“
„Hm. Weiß nicht. War noch nie da.“ Er wirkt desinteressiert. „Warte mal“, sagt er dann, „da war so’ne komische Sache mit den ‚Menschen aus Eisen‘: Das sind drei Stahlskulpturen von einem Künstler mit einem unaussprechlichen Namen. Sie sollen den Kampf der Stahlwerker um den Standort symbolisieren und stehen vor dem Bruchtorturm. Und weil sie – na ja – nackt sind, also, man sieht ihr Gemächt, hat man ihnen immer mal wieder Unterwäsche angezogen.“ Er ist sichtlich verlegen, und ich lache mich innerlich kaputt. Ich stelle mir das in den Industriebrachen von Leipzig-Plagwitz vor.
„Und? Hat man die Rowdies erwischt?“
„Nein, aber die Leute haben etwas, worüber sie sich aufregen können. Der Ausländerbeirat der Stadt hatte Bedenken angemeldet. Aber die Figuren stehen trotzdem noch da.“
Mir wird klar, daß ich auf Gerd in dieser Sache nicht zählen kann. Ich verabschiede mich und mache einen Reiseplan. Madame wird sich wundern.
Ich war noch nie im Ruhrpott, etwas über 500 Kilometer beträgt die Entfernung, und ich bin froh, daß ich ein Navi habe. Mein kleiner Skoda ist nicht der Schnellste, aber er ist zuverlässig und verbraucht nicht viel. Am nächsten Tag bin ich am Nachmittag in Hattingen am Museumsgelände. Es gibt überall Parkplätze, und ich stelle den Skoda ab. Dann kaufe ich mir eine Eintrittskarte, ich will mir einen Eindruck verschaffen. Offiziell heißt es „LWL-Industriemuseum“, und LWL ist die Abkürzung für „Landschaftsverband Westfalen-Lippe“. Ich habe immer überlegt, ob es denn auch ein Ostfalen gäbe, und inzwischen weiß ich es. Das Gelände des Museums ist riesig, und man kann die verschiedenen Stadien der Stahlerzeugung von der Eisenverhüttung im Hochofen über das Ausblasen des Kohlenstoffs bis hin zum Abstich und das Walzen des fertigen Stahls erkunden.
Ich schlendere über das Gelände. Die Werkhallen wecken Erinnerungen, und der Hochofen nötigt mir Respekt ab, so etwas kenne ich nur aus dem Fernsehen. Aber jetzt habe ich Hunger. Ich suche „Henrichs Restaurant“ auf und bin überrascht. In meinen jungen Jahren habe ich einige Werkhallen und Werkstätten in ihren verschiedenen Verfallsstadien kennengelernt. Auch neue Werkhallen, aber das hier ist beeindruckend. Das Restaurant ist in eine alte Werkhalle eingebaut, und man denkt, man sitzt in der „Meisterbude“, und die Stahltreppen und Laufgänge der Halle sind organisch in die Architektur eingebunden. Ich hätte auch den Imbißstand aufsuchen können, aber das Wetter ist nicht danach. Ich bestelle also ein Essen und ein Getränk und stille Hunger und Durst. Madame wird die Stirn runzeln. Dann verlasse ich das Museum und suche mir ein kleines Hotel. Morgen werde ich weitersehen.
Im Hotel bekomme ich eine Broschüre, und ich beschäftige mich an der Bar mit einem Cuba Libre und der Geschichte des Stahlwerkes. „Graf Henrich zu Stolberg-Wernigerode“ – ach guck mal, ein Ossi! – „gründete 1854 die Hütte, die über Jahrzehnte zu einem gigantischen Werk mit verschiedenen Betrieben heranwuchs. Die Henrichshütte lieferte ein breites Spektrum von Produkten aus Eisen und Stahl, von der Schiffsschraube bis zum Raketenbauteil, vom Autoblech bis zum Panzergehäuse.“
„So so“, denke ich. „Auch Panzergehäuse.“
Na schön. Ich plane im Kopf mein weiteres Vorgehen. Dann trinke ich meinen Cuba Libre aus und gehe schlafen.
Am anderen Morgen sitze ich beim Frühstück und lasse mir Eier und Schinken schmecken. Es ist ein ganz ausgezeichnetes Frühstück, und ich bin hochzufrieden. Ich werfe einen gelangweilten Blick in die „Hattinger Zeitung“, und ich stutze. „Endlich Kulturschänder festgenommen!“ lautet die Schlagzeile. Ich lese den kurzen Artikel. Man habe endlich den mutmaßlichen Täter verhaftet, der den „Menschen aus Eisen“ immer wieder Unterwäsche angezogen haben soll, um ihre Blöße zu bedecken. Zum Artikel ein verfremdetes Foto des „Schänders“, man hat ihm einen schwarzen Balken über die Augen gelegt. Ich vergleiche es mit dem Foto, das mir Madame überlassen hat. Kein Zweifel, das ist er! Polizeigewahrsam für einen abgängigen Ehegatten! Das ist auch keine Lösung, denke ich, aber ich habe wenigstens knallharte Fakten für meinen Bericht. Die Fakten aber werden Madame nicht gefallen …
© Bernd Mai – Leipzig, Mai 2012