von Bernd Mai
Antons Haltung zum Adel steht fest, seit er als Junge „Die Fahne des Pfeiferhänslein“ und „Das Regenbogenfähnlein“ gelesen hatte. Wenn es im Fernsehen um die Damen und Herren Von-Und-Zu geht, egal, ob Dokumentation oder „Das Haus am Eton Place“, kann er sich in der Regel boshafte Bemerkungen nicht verkneifen. „Adelsgesocks“ ist der mildeste Ausdruck, der ihm einfällt. Ist Bettina zugegen, schimpft sie mit ihm. Da kann Anton zum Eiferer werden.
„Was glaubst du, wie die zu ihrem Reichtum gekommen sind?“ fragt er dann.
Bettina weiß es nicht, und Anton fängt an klugzuscheißen und hält Vorträge über gestohlene Allmende und das Bauernlegen. Aber das will Bettina nicht gelten lassen. Das heißt, sie ließ es nicht gelten, bis sie einen mehrbändigen historischen Roman gelesen hatte, dessen Handlung in der fraglichen Zeit spielt. Über die literarische Qualität des Werkes schweigt Anton, denn wer im Glashaus sitzt … Aber die Autorin hatte genau recherchiert und sich an historisch erwiesene Tatsachen gehalten, und Bettina war, gelinde gesagt, erschüttert. Seitdem ist ihr Protest gegen Antons Schmähreden verhaltener geworden. Aber Bettina wäre nicht Bettina, wenn sie ihn ganz unterlassen hätte.
Anton ist in seinem Leben zwei echten Adligen begegnet. Der erste hieß Herr von Knoblauch und ist ein Kollege seines Vaters gewesen. Anton war ein Junge von zehn, zwölf Jahren und wurde ins Ferienlager geschickt, das der Betrieb seines Vaters jedes Jahr ausrichtete. Anton haßte es, aber er wurde nicht gefragt. Die Kinder waren in Altersgruppen nach Jungen und Mädchen organisiert, und die Betreuer einer Gruppe nannte man Helfer. Meist waren die Helfer Pädagogikstudenten, aber manchmal, wenn sich nicht genügend Studenten gefunden hatten, wurden auch Mitarbeiter des Betriebes für diese Tätigkeit abgestellt. So auch Herr von Knoblauch, aber vielleicht ist ja auch alles ganz anders gewesen. Die Jungen seiner Gruppe nannten ihren Helfer einfach „Herr Knoblauch“, und Anton fand es befremdlich, als die Mutter eines seiner Kameraden, die ihren Sohn an einem Wochenende besuchte, ihren sanften, netten und besonnenen Gruppenleiter, der auch ein rechter Witzbold sein konnte, ausdrücklich und steif mit „Herr von Knoblauch“ anredete. Nein, reich ist Herr von Knoblauch wohl nicht gewesen. Welche Tätigkeit er im Betrieb ausübte, hat Anton nie erfahren, und es hat ihn auch nie interessiert.
Der Zweite war ein französischer Adliger, der zehnte Marquis de P.
Bettina wollte in den Westen unseres Landes reisen. Ihr schwebte „Rhein in Flammen“ vor, aber um den Schein zu wahren, bot sie Anton als Alternative „Barock made in Saarland“ an. Anton mußte nicht lange nachdenken. Bettina buchte eine Busreise mit ihrem Lieblingsreiseunternehmen, und in Saarlouis fanden sie Herberge. Von Saarlouis aus unternahm man täglich ausgedehnte Ausflüge. Zum Beispiel in die Landeshauptstadt, nach Luxemburg und das nahe gelegene Elsaß.
Das Hotel war schäbig und unbequem, die Zimmer winzig. Diesen Mangel versuchte man durch ewig ausgedehnte Abendessen mit musikalischen Einlagen zu kaschieren. Man hoffte, die Gäste würden danach müde und beschwipst nichts anderes als schlafen wollen und nicht mehr nach dem fehlenden Komfort fragen. Bei Anton funktionierte das nicht. Das Essen war mittelmäßig, der Service überfordert. Die Mitreisenden gingen Anton auf die Nerven. Er zog sich gewöhnlich schon lange vor dem Dessert in die Hotelbar zurück, um seine Stimmung mit ein paar Gläsern Karlsberg, einem lokalen Bier, aufzuhellen. Sie hatten auch einen guten Schnaps, den sie „Saarschnaps“ nannten, und Anton fand heraus, daß es sich um einen Obstbrand handelte, der ihm ausgezeichnet schmeckte. Am Abreisetag weigerte sich der Busfahrer nach der Abfahrt eine Schleife um den Block zu fahren, um einem Mitreisender zu ermöglichen, seine vergessene Brille aus dem Hotel zu holen. Da beschloß Anton endgültig, das Reiseunternehmen in Zukunft zu meiden.
Ihr örtlicher Reiseleiter hieß Johann Kiefer, aber er bestand darauf, Jean genannt zu werden. Anton nannte ihn im Stillen „Mißjöh Schang“. Er war von Geburt Elsässer und der Liebe wegen ins Saarland gezogen. Er war überzeugter Europäer, und während der Busfahrten unterhielt er die Reisegesellschaft mit Geschichten über seine Familie, die mal preußisch, mal französisch, mal deutsch und mal irgendwas gewesen war. Die Pointe der Geschichten aber war immer die selbe: „Jetzt sind wir alle Europäer, und das ist gut so.“
Wo er recht hat, hat er recht, dachte Anton. Aber er sah auch das Unverständnis in den Augen mancher seiner Mitreisenden.
Am dritten Tag fuhren sie nach Metz in Lothringen. Nach dem Besichtigungsprogramm, Anton hatte sich zum Mittag ein Sandwich und eine Flasche Cidre an einem Stand gekauft, die Kathedrale und die Markthalle wollten verdaut werden, machten sie einen Abstecher nach P. Mißjöh Schang hatte ihnen einen leibhaftigen Markgrafen und ein Barockschloß versprochen. Das Schloß entpuppte sich als Schlößchen, so etwas ähnliches hatten sie in Ostrau, in Bettinas unmittelbarer Umgebung, auch, nichts Besonderes. In Ostrau diente das Schloß als Grundschule. Das Schloß in P. hätte der französische Staat nach dem Krieg als Kinderheim genutzt, erfuhr Anton später. Der bauliche Zustand beider Schlösser war ähnlich, sie waren beide stark instandsetzungsbedürftig, etwa im selben Ausmaß. Beide Schlösser verfügten über einen weitläufigen Park, und Anton schätzte den französischen um einiges größer. Ziemlich mickrig für einen Markgrafen, dachte Anton, und er hatte die sächsischen Wettiner, die Markgrafen von Meißen, im Kopf. Er konnte nicht wissen, daß der Titel in Frankreich schon lange keine Funktion mehr bezeichnet und unter Adligen nichts besonderes ist. Der Marquis sei Forstwirt, er besäße ausgedehnte Wälder in der Umgebung erklärte Mißjöh Schang auf Antons Nachfrage, das Schloß verschlänge riesige Summen, und die zum Schloß gehörenden Ländereien gehörten ihm schon lange nicht mehr. Na immerhin, dachte Anton, der Diebstahl der Allmende hat sich also auch in Frankreich gelohnt.
Der Marquis erwartete sie standesgemäß an einer angedeuteten Zugbrücke. Er hielt eine kleine Rede, die Mißjöh Schang getreulich, wenn auch ein wenig holprig, ins Deutsche übersetzte. Dann setzte sich die Gruppe zögerlich in Bewegung. Zunächst wurde der Park besichtigt. Hier ein Rosenarrangement, da Stauden und Kräuter. Dort ein kleiner Brunnen mit einem Putto als Brunnenskulptur, und da ein kleiner Teich, der aus einem Bächlein gespeist wurde. Ein zierliches japanisches Brücklein drohte unter der Last der vielen Touristen schier zusammenzubrechen. Uralte Eichen säumten die Wege, hier und da eine kokette Barockstatue, die Büsche waren streng symmetrisch gestutzt. Alles sehr schön, fand Anton, aber er langweilte sich. In Gärten und Parks langweilt Anton sich immer. Der Park wurde an der Westseite durch ein Flüßchen begrenzt, von dessen jenseitigem Ufer weite Felder und Wiesen herübergrüßten. Nun ja, aber die gehören ihm ja schon längst nicht mehr, dachte Anton und er verzog die Mundwinkel.
Die Parkbegehung war zu Ende. Anton wurde an seinen Vater erinnert, der jeden Gast in seinem Schrebergarten nach einem Begrüßungsschluck stets zu einem Gartenrundgang nötigte. Den Begrüßungsschluck hatte ihnen Mißjöh Schang jedoch im Anschluß versprochen. Auf dem Weg zum Schloß kamen sie an einem Wirtschaftshof vorüber. Alle Geräte und Utensilien waren ordentlich abgestellt, nichts lag herum. Auf einer Bank döste eine grau getigerte Katze in der Sonne, die die Besucher mit einem trägen Lidaufschlag registrierte. Bevor sie das Schloß betraten, hielt der Marquis wieder eine kurze Ansprache, dann wurden sie ins Haus gebeten. Man besichtigte die repräsentativen Räume, im Salon wurden sie ausdrücklich aufgefordert, auf den barock wirkenden Sesseln und Stühlen Platz zu nehmen. Anton aber hatte zu oft die Sendung „Kunst und Krempel“ vom Bayerischen Rundfunk gesehen und war mißtrauisch. Besonders bequem fand er die Sitzmöbel sowieso nicht. Wie immer, wenn er Schlösser oder Burgen besichtigt, versuchte er sich gegen den erdrückenden Eindruck von Reichtum und Pracht zu wehren, indem er an seine eigenen Vorfahren dachte, und wie die wohl zu jener Zeit im armen Erzgebirge, die hohe Zeit der Erzgewinnung war schon lange vorbei, gelebt haben könnten. Anton hatte nach der Bedeutung seines Familiennamens Mertz geforscht, aber nicht viel gefunden. Am ehesten weist er auf eine Abgabe hin, die im Monat März fällig gewesen war, welche blieb unklar. Daraus schloß Anton, daß seine Vorfahren abhängige, leibeigene oder hörige Bauern gewesen waren, bestenfalls. Vielleicht waren sie ja auch nur Tagelöhner gewesen, die in einer dreckigen Erdhütte gelebt hatten, und die froh gewesen sein mußten, wenn sie überhaupt etwas zu essen gehabt hatten und ihre Blöße mit ein paar stinkenden Lumpen bedecken konnten. Dafür darf heute euer Nachfahre durch all die Pracht schlendern und seinen Schönheitssinn entwickeln, dachte Anton voller Hohn. Scheißadelsgesocks!
Am Ende der Besichtigung versammelte man sich im Festsaal, es waren etliche Stühle aufgestellt, aber es waren moderne Stühle, wie man sie in jedem Imbiß und jeder Kneipe überall auf der Welt findet. Man möge Fragen stellen, Madame Marquise übernahm den Vorsitz, es wurde Wasser, Kaffee und Tee in Plastikbechern gereicht. Anton zog es vor, sich zu verdrücken, er verließ das Schloß, um nach interessanten Fotomotiven zu suchen. Der Wirtschaftshof, so hatte er gesehen, bot einige. Die Katze döste noch immer auf der Bank, und Anton setzte sich zu ihr. Sie erhob sich langsam und hoheitsvoll, reckte und streckte sich und begutachtete den Eindringling. Anton streckte seinen linken Arm aus und hielt ihr die Hand hin, damit sie daran schnuppern konnte, ganz wie er es zu Hause bei Luzie, der Katze von Bettinas Enkeln machte, und die Katze tat ihm Bescheid. Dann gab sie Köpfchen und holte sich ein paar Streicheleinheiten ab, wobei sie einen Buckel machte, die Augen zusammenkniff und den Schwanz aufrichtete.
„Bonjoure, Madame“, sagte Anton.
„Mau!“
„Ich hoffe, Madame haben wohl geruht?“
„Mauuu …“
Jenseits der Parkumfriedung lag das Dorf P., und der neugotische Turm der Dorfkirche hätte auch daheim in der Lommatzscher Pflege stehen können.
Anton hatte genug fotografiert. Er ging zurück zum Schloß. In der Lobby standen ein paar Tische, als hätte man sie nur mal eben dort abgestellt. Einige waren verkehrt herum auf anderen Tischen gestapelt. Vielleicht warteten sie auf ihren Einsatz beim nächsten Parkfest. Ein Stapel Bücher neben einem großen Postkarton auf einem der Tische erregte Antons Aufmerksamkeit. Die Bücher erweckten den Eindruck, als kämen sie direkt aus der Druckerei, sie waren noch in durchsichtiger Plastikfolie verpackt, nur zwei von ihnen hatte man von der Folie befreit, die man achtlos hatte auf den Boden fallen lassen. Anton nahm einen der Paperbackbände in die Hand. Auf dem Cover waren in Comicmanier ein Jagdflugzeug mit Propeller abgebildet, am Heckleitwerk und am Rumpf war ein fünfzackiger roter Stern zu sehen. Anton stutzte. Auf dem Einband waren ein paar kleine kreisrunde Porträts von jungen Männern angeordnet, allesamt Flieger mit französischen Militärmützen, wie sie sie im zweiten Weltkrieg getragen hatten, glaubte Anton zu erkennen. „Escadre Normandie-Niémen“ stand in flammend roter Schrift auf dem Einband. Anton erinnerte sich an den Film, den er als junger Mensch im Kino gesehen hatte, es mußte Anfang der sechziger Jahre gewesen sein. Der Film hatte den jungen Anton sehr beeindruckt, und er hatte ihn, im Gegensatz zu anderen Kriegsfilmen aus Sowjetproduktion, bis heute nicht vergessen. Französische Jagdflieger des Freien Frankreich hatten auf sowjetischer Seite gegen die Deutschen gekämpft. Wieso lagen diese Bücher hier herum? Dafür hatte Anton nur eine Erklärung. Er nahm einen Band an sich und wollte gerade das Vestibül verlassen, als der Marquis durch die Tür trat. Er sah Anton und lächelte ihm zu. Anton hob das Buch, zeigte ihm den Einband und zog die Augenbrauen fragend nach oben.
„Haben sie etwas damit zu tun?“, fragte er auf deutsch, in der Hoffnung, der Marquis möge ihn verstehen. Und dann, als er das ratlose Gesicht seines Gegenüber sah: „Do you speak English?“
Die Miene des Marquis hellte sich auf, und er erklärte Anton, daß er das Englische wohl beherrsche, jedoch ziemlich schlecht. Da sind wir schon zwei, dachte Anton.
„Haben sie etwas damit zu tun?“ fragte Anton auf englisch.
„Oh ja, mein Vater war einer der Piloten. Aber sagen sie, woher wissen sie darüber bescheid?“
„Ich sah den Film, vor vielen Jahren. Da war ich noch sehr jung.“ Anton lächelt entschuldigend, als müsse er sich für sein Alter schämen. Der Marquis war fast so alt wie Anton, nur war er schlanker, und er sah besser aus. Französischer Adel eben, nicht ganz wie Jean Marais in „Ritter der Nacht“, aber immerhin …
„Kommen sie, ich zeige ihnen etwas“, sagte der Marquis, streckte seinen Arm in Richtung der Treppe zum Obergeschoß aus und ging voraus. Im Obergeschoß dirigierte er Anton durch ein paar Räume, die alle aussahen, als würde gleich die Malerbrigade von der Mittagspause aus der Brasserie des Dorfes zurückkehren. Vor einer kleinen Tür blieb der Marquis stehen. Er lächelte Anton gewinnend an, holte einen Schlüssel aus der Hosentasche und schloß umständlich die Tür auf.
„Treten sie bitte ein!“, sagte er feierlich und betätigte einen Lichtschalter neben der Tür. Ein paar Strahler gingen an und beleuchteten eine Szene wie in einem Museum. An den Wänden hingen Schautafeln mit Fotos und Faksimiles von Schriftstücken, in Vitrinen waren Orden, Rangabzeichen und persönliche Dinge wie Zigarettenetuis, Tabakspfeifen, Taschenmesser, Uhren, Geldbörsen und Brillenetuis ausgestellt. Sogar ein Kamm war dabei. Der Raum war nicht groß, kleiner als Antons Wohnzimmer, und er war mit Exponaten vollgestopft. In einer mannshohen Vitrine hing eine komplette Uniform. Anton stand davor und staunte.
„Das ist die Uniform, die mein Vater getragen hat.“
„Sie sind sicher sehr stolz auf ihn, nicht wahr?“
„Er hat die Ehre Frankreichs verteidigt.“
Anton dachte an seinen eigenen Vater. Er ist kein Nazi gewesen, und er hat nur getan, was man ihm befohlen hatte. Seinen Beteuerungen, als Soldat nie jemanden umgebracht zu haben, er ist Kfz-Mechaniker bei der Truppenflak gewesen, hat er nur zu gern geglaubt. Aber er mußte auch an die dunklen Andeutungen seines Bruders denken, daß da zu Beginn des Krieges „irgendwas in Polen“ gewesen sein müsse. Den Erzählungen des Vaters gemäß sei er immer nur in Italien am Gardasee gewesen und hätte Vino und Grappa getrunken und einer glutäugigen Italienerin den Hof gemacht. Am Ende hätte sich herausgestellt, daß die Dame seines Herzens die Chefin der lokalen Resistenza gewesen war. Als sich ihre Flak-Batterie den Engländern ergeben habe, hätte sie, gewandet in eine schwarze Lederjacke und mit einer riesigen Pistolentasche am Koppel, flankiert von zwei finster dreinblickenden jungen Burschen mit deutschen Maschinenpistolen vor der Brust und mit roten Halstüchern angetan, neben dem britischen Kommandeur gestanden, auf ihn gewiesen und lächelnd etwas zu dem Engländer gesagt, hatte Antons Vater des Öfteren erzählt. Es sei zu weit entfernt gewesen, als daß er hätte verstehen können, was die schöne Amazone gesagt hatte. Dabei sah Antons Vater immer sehr betrübt aus, und um seine Lippen spielte ein beschämtes Lächeln.
„Salude, ’ne Leiche, drei Tute“, hatte er dann immer gebrummt und sein Glas ausgetrunken. Dieser Satz hatte jedes Mal das Ende seiner Erzählungen signalisiert.
In einer Nische neben einem Fenster hing unter Glas eine Urkunde. Das Exponat wurde von einem speziellen Spotlicht angestrahlt. Oben auf dem Schriftstück prangte das Wappen der Sowjetunion, der Text war in kyrillischer Schrift gehalten. „Герой Советского Союза“ (Geroj Sovetskogo Sojuza – Held der Sowjetunion) entzifferte Anton, seine Russischkenntnisse waren zwar verschüttet, aber immer noch präsent. Die Urkunde war für Kapitan Alain de P. ausgestellt. Halblaut las Anton den russischen Text, und der Marquis lauschte und machte große Augen. Der Orden, ein goldener fünfzackiger Stern an einer schlichten roten Ordensspange, war in einem Glaskasten, der unter der Urkunde an der Wand befestigt war, zu sehen. Anton mußte sich einer gewissen Ergriffenheit erwehren. Der Marquis beobachtete aufmerksam seinen Gast, und Anton nickte anerkennend. Da mußte man gar nichts mehr sagen.
Auf dem Korridor wurde es laut. Die anderen Mitreisenden kamen, um das Kabinett zu besichtigen. Anton bedankte sich beim Marquis und verdrückte sich durch die hereindrängende Menge nach draußen. Er ging noch einmal hinüber zum Wirtschaftshof, und nach längerem Schauen entdeckte er tatsächlich noch ein paar Motive für die Kamera. Die Katze war inzwischen ihrer Wege gegangen.
Die Zeit war vorangeschritten, man versammelte sich am Bus. Die Mitreisenden trudelten nacheinander ein, und Mißjöh Schang bat sie, noch ein wenig auszuharren. Der Markgraf wolle sich noch verabschieden. Der ließ nicht lange auf sich warten. Die Prozedur wiederholte sich, kurze Ansprache, Mißjöh Schang übersetzte, allgemeines Händeschütteln. Als Anton in den Bus einsteigen wollte, kam der Marquis mit ausgestreckten Händen auf ihn zu.
„Es war nett, sie kennenzulernen“, sagte er auf englisch. „Woher kommen sie eigentlich?“
„Ich bin Sachse, aus Leipzig“, entgegnete Anton. Über das Gesicht des Marquis huschte ein verstehendes Lächeln. „Aber die anderen sind aus Halle.“
„Oh, Halle in Westfalen! Das Tennisturnier ist sehr bekannt.“
„Nein. Halle an der Saale, das ist in Sachsen-Anhalt. Dort gibt’s nur Fußball.“
Der Marquis schaute verständnislos, aber Anton hatte keine Lust, ihm die komplizierten föderalen Strukturen Deutschlands zu erklären. Seine Englischkenntnisse hätten kaum ausgereicht.
„Vielen Dank für ihre Gastfreundschaft“, sagte er deshalb nur. Einige Mitreisende waren aufmerksam geworden und hatten sich um die beiden ältlichen Männer geschart, die so freundlich in einer fremden Sprache miteinander parlierten.
„Keine Ursache“, sagte der Marquis. „Wenn sie mal wieder in der Gegend sind, kommen sie doch zum Tee vorbei.“
„Vielen Dank. Und grüßen sie ihre Gattin.“ Anton kam sich ziemlich albern vor, aber er glaubte, die richtigen Worte gefunden zu haben. Der Marquis schüttelte ihm die Hand.
„Vive la France!“, sagte Anton und nahm dabei seine Mütze ab. Das hatte er in einem französischen Film über die Résistance so gesehen.
„Es läbbe der französisch-deutsche Fröndschahft“, erwiderte der Marquis.
Mißjöh Schang, der überzeugte Europäer, klatschte spontan Beifall, und ein paar Mitreisende fielen ein. Und jetzt sollte das Orchester die Marseillaise spielen, dachte Anton, und er spürte, wie er einen roten Kopf bekam.
Copyright © Bernd Mai, Mai 2016 Leipzig und Löbejün
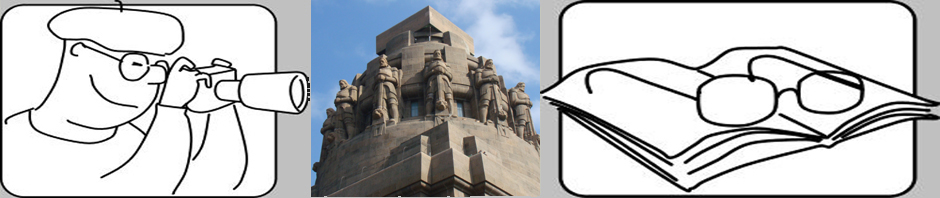
Danke für die neue interessante Anton-Geschichte.