Das kleine Einmaleins
Ein Feuilleton
von Bernd Mai
Ich begann zu schreiben, als ich schon fast Ende zwanzig war. Ich war verheiratet und hatte zwei Kinder. Ich aber war noch immer nicht über eine verlorene Liebe aus vergangenen Zeiten hinweggekommen. Manchmal dachte ich mir Szenarien aus, in denen ich SIE wiedersah, eine unterbliebene Aussprache nachholte, und dann die Geliebte zurückgewann. Daran können wir leicht erkennen, daß meine Ehe nicht gut lief. Je mehr aber die Zeit voranschritt, umso zweifelhafter wurde die Idee des „Zurückgewinnens“. Ich habe eigentlich einen realistischen und analytischen Sinn, und irgendwann wurde mir klar, daß die verlorene Geliebte zwar eine großartige Frau gewesen war, daß aber ihre Lebensziele nichts mit den meinen zu tun hatten. Einmal gestand sie mir, daß es ihr größter Wunsch sei, so viel Geld zu verdienen, daß sie sich komplett von Kopf bis Fuß im „Exquisit“-Laden neu einkleiden könne. Und dann wollte sie im Interhotel „Astoria“ ganz, ganz schick essen gehen. Sie war Studentin an der Handelshochschule, und sie stammte aus der mecklenburgischen Provinz. Aber leben wollte sie später immer nur in „Berlin – Hauptstadt“, dort, wo die Entscheidungen gefällt und die guten Gehälter verdient werden. Ich hatte das nicht ernst genommen, was kümmerte mich „Exquisit“, was berührte mich „Delikat“? Und um „Intershop“ sorgte ich mich gleich gar nicht. Mit meinem Gehalt war ich zwar nicht ganz zufrieden, aber es können ja nicht alle nach Berlin umsiedeln, nicht wahr? Ich kaufte im „Konsum“ und in der „HO“ ein, oder beim Privatfleischer, Privatbäcker oder in der HO-“Kondi“(torei) um die Ecke, und ich hielt die Gründung der bewußten Handelseinrichtungen, mit denen Kaufkraft und Westgeld abgeschöpft werden sollte, ideologisch sowieso für falsch. Von der Schere zwischen Kaufkraft und Angebot – also vom Markt in Schräglage – hatte ich damals keine Ahnung.
Ich wollte literarisch mit meiner Verflossenen abrechnen, oder wenigstens mit ihren spießigen Lebensplänen. Ich dachte mir eine Geschichte aus. Mein Held muß eine Dienstreise antreten, und die führt ihn zufällig in den Wohnort seiner ehemaligen Geliebten, einem verschlafenen Provinznest. Woher er ihre Anschrift kennt, ließ ich offen. Er erledigt seine Angelegenheiten umgehend, und er beschließt, sie aufzusuchen. Sie ist zu Hause, und sie reden miteinander, und mein Held erkennt die Spießigkeit, die Hohlheit und das Morbide seiner ehemaligen Geliebten – die blanke Banalität des real existierenden Sozialismus. Sie hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt und verändert. Auto, Auslandsreisen, Farbfernseher, Stereoanlage, Datsche, momentan stören Kinder – das verschiebt man auf später, schicke Exquisit-Klamotten, Beziehungen zum „Provinzfürsten“, die Liste nimmt kein Ende. Nur mit „Berlin – Hauptstadt“ hat es bisher nicht geklappt, aber wer weiß … In Wirklichkeit ging es um Standesunterschiede, die Jagd nach materiellen Gütern, das Anbeten von falschen Idealen. Aber worin die wahren Ideale bestehen, wußte auch ich nicht, und mein Held gleich gar nicht. Damit wir uns richtig verstehen: das alles spielte sich Anfang der 70er Jahren in der DDR ab, die eigentlich für ganz andere Werte angetreten war. Ich skizzierte eine Führungsschicht, die vom relativen Wohlstand der sechziger Jahre korrumpiert war. Und ich beschrieb eine Arbeiterklasse, die schon jetzt, und nicht erst in einer utopischen Zukunft, in der der Sozialismus gesiegt haben würde, besser leben wollte. Sie sahen es nicht nur im Westfernsehen. Die Nomenklatura, selbständige Handwerker und Gewerbetreibende, Künstler und Schauspieler und die „werktätigen Bauern“ lebten es ihnen vor. Entgegen den Beteuerungen des „Neuen Deutschland“ rangierte die Arbeiterklasse am unteren Ende der Nahrungskette. Das führte dazu, daß sie sehr erfindungsreich sein mußte, um ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Auch das wollte ich gestalten.
Ich setzte mich hin und schrieb. Zuerst mit der Hand. Wie lange ich an der Geschichte gearbeitet habe, weiß ich nicht mehr. Dann lieh ich mir von einem Freund eine Reiseschreibmaschine der Marke „Erika“.
Sie hatte stolze 435 Mark (Ost) gekostet, mehr als die Hälfte meines Bruttomonatsgehaltes, und der Freund hielt mir einen Belehrungsvortrag, der netto etwa eine Stunde dauerte. Brutto, wir tranken gemeinsam eine Flasche Doppelkorn der Marke „Nordhäuser“ aus und stießen immer wieder auf meine Zukunft als Schriftsteller an, war sie wesentlich länger. Mit der Maschine schrieb ich das Manuskript ab. Das dauerte ungefähr eine Woche und es war sehr mühsam, das weiß ich noch genau. Wieviel Tapp-ex, so hieß das Tipp-ex in der DDR, ich verbraucht habe , weiß ich auch nicht mehr.
Das maschinengeschriebene Manuskript schickte ich an die Zeitschrift „Neue Deutsche Literatur“, das Organ des Schriftstellerverbandes. Ich weiß nicht mehr, ob es Naivität oder Unverschämtheit war, daß ich mich ausgerechnet an die hochangesehene Zeitschrift der „echten“ Schriftsteller und Literaturkritiker wandte. Ich wollte einfach wissen, was Fachleute dazu sagen. Nach einigen Wochen, ich glaubte schon nicht mehr daran, bekam ich mein Manuskript zurück, begleitet vom Brief einer Redakteurin. Der Brief war lang, und es war kein Standard-Ablehnungsbrief. Man hatte sich tatsächlich Zeit genommen und mit meiner Geschichte befaßt! Und sie war immerhin achtzehn Seiten lang. Die Kritik war in freundlichen Worten verfaßt, und die Redakteurin steckte die Finger in die Wunden, die mich sowieso schon schmerzten. Am Ende gab sie mir den Rat, ich möge mich einem „Zirkel Schreibender Arbeiter“ anschließen, da könnte ich etwas lernen. „Aber diese Geschichte … nein, diese wirklich nicht.“ Aber ich war zufrieden. Die Sublimierung hatte funktioniert, und ich war das Trauma los.
Einige Zeit später, es muß 1977 gewesen sein, bekam ich Hemingways „49 Stories“ in die Hände.
Es war als Taschenbuchausgabe in zwei Bänden in der sehr verdienstvollen Reihe „Taschenbibliothek der Weltliteratur“ im Aufbau-Verlag erschienen. Die Schwiegermutter meines Bruders, die beim Postzeitungsvertrieb in einem Kiosk arbeitete und mir immer die „Bückware“ aufhob, hatte es mir zurückgelegt.
Die Stories faszinierten mich auf der Stelle. So wollte ich auch schreiben können! Ich las sie immer und immer wieder, vor allem die ganz Kurzen, und ich studierte Hemingways Technik. Ich hatte damals noch nichts von seiner Theorie der „Vierten und Fünften Dimension“ gehört, aber gefühlt, gefühlt hatte ich es irgendwie schon. Anläßlich einer Ehekrise, ich wollte mal wieder sublimieren, schrieb ich eine Kurzgeschichte. Sie war nur anderthalb Seiten lang, und ich nannte sie in echter Hemingway-Manier „Früh am Morgen und etwas später“. Mit ihr und einer anderen, die auch nicht länger war, gewann ich später den zweiten Preis bei einem Wettbewerb, den die Gewerkschaftszeitung „Tribüne“ ausgeschrieben hatte.
Ich wurde Mitglied eines „Zirkels Schreibender Arbeiter“, lernte viele interessante Menschen kennen, fand Zugang zu Literatenkreisen und lernte das Einmaleins des Schreibens. Aber nur das Kleine. Und das ist schwer genug …
Anmerkung:
Ich verkneife es mir, hier Anmerkungen zu DDR-typischen Namen und Begriffen zu machen. Stattdessen habe ich etliche Begriffe mit Artikeln in Wikipedia und anderswo verlinkt.
Viel Spaß!
© Bernd Mai, Leipzig & Wettin-Löbejün, September 2013
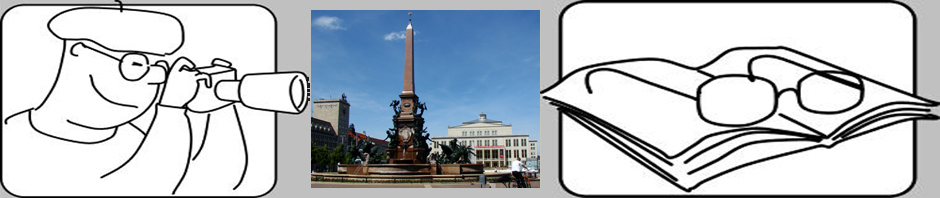


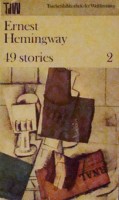
Lieber Bernd,
eine wahnsinnig schöne Geschichte mit einer sehr tiefgehenden Bedeutung. Schade das ich Dich nicht schon vor 25 Jahren kennen gelernt habe, denn dann hätte ich Dich einem mir damalig, sehr engen und lieben Freund, vorstellen können. Dieser war Verlagsdirektor bei einem Münchener Buchverlag und hat selber nebenher geschrieben. Ich glaube schon vom Typ her hättet ihr Euch sehr gut verstanden.
Dieser Mann war trotz seiner Position als Verlagsdirektor eine sehr schlichtweg einfache Persönlichkeit geblieben was ihn auch bei sehr vielen Autoren auszeichnete.
Schade, er liebte nämlich grade solche Geschichten wie Deine aus der DDR.
Manchmal kann das Leben echt bescheiden blöde sein.
Liebe Grüße, Daggi