von Bernd Mai
Er wachte um vier Uhr auf, es war an einem Sonnabend, und fünf Minuten später wußte er, daß er nicht wieder einschlafen würde. Er ging in die Küche und holte sich ein Glas Wasser. Dann hob er die Brille und das Buch vom Boden auf, legte sich wieder hin und schaltete das Radio ein. Er suchte ruhige Musik im Radio, trank das Wasser zur Hälfte und ruckelte sich zurecht. Das Lesezeichen lag unbenutzt auf dem Nachttisch, aber er fand schnell die Stelle, an der er seine Lektüre unterbrochen hatte. Dann trank er den Rest des Wassers. Nachdem er zwei Seiten gelesen hatte, wurde er wieder schläfrig.
Nachdem er über eine halbe Stunde lang gedämmert hatte, fiel er in einen kurzen, leichten Schlaf. Er erwachte, nachdem er die drei Musketiere mit dem Degen umgebracht hatte. Er hatte sie erwischt, als sie sich gerade auszogen, um die Königin zu vergewaltigen. Die Königin kehrte ihnen den Rücken zu. Sie winkte dem König, und die drei Kerle zogen sich hinter Säulen versteckt aus, nachdem der König ihnen ein Zeichen gegeben hatte. Der Erste verteidigte sich noch, aber er hatte keine Chance, weil er sich ständig in seinen heruntergelassenen Hosen verhedderte. Dann nahm er sich den Zweiten vor, und der Dritte war umgefallen, bevor der Degen ihn berührte. Er hätte auch gern noch den König erledigt, aber der Hundsfott war schon weg, und das war unbefriedigend.
Er haßte Träume, in denen sich immer das gleiche Motiv wiederholte, und die niemals eine Lösung brachten. Er wünschte sich manchmal in seine Kindheit zurück, in die Zeit, als er noch in der Lage war, seine Träume zu steuern, und als er noch bestimmen konnte, ob ein Traummotiv fortgesetzt werden sollte oder nicht, und daß es keine schlechtes Ende nehmen sollte mit Angstschweiß und klopfendem Herzen beim Aufwachen. Die Phase, in der er sich selbst im Traum befehlen konnte aufzuwachen, weil alles nicht so schlimm und nur ein Traum war, kam erst viel später, und inzwischen spürte er Angst und Verzweiflung im Traum nur noch selten. Dafür war er dankbar, und meistens kam er sich vor, als säße er vor dem Fernseher, und wenn er etwas spürte, dann war es Neugier, wie es weiterging, und Ärger darüber, daß er den König, den Hundsfott, wieder nicht erwischt hatte.
Es war erst kurz nach sechs, und das Leuchtdisplay seines Weckradios schien höhnisch zu grinsen, denn es war ja Sonnabend, und draußen war es noch dunkel. Er stand auf. Nachdem er sein Wasser abgeschlagen und Toilette gemacht hatte, bereitete er sich ein Frühstück. Er nahm vier Maß Kaffee auf drei Tassen, und während die Kaffeemaschine blubberte, stellte er Wasser für den Tee und das Ei auf den Herd. Dann schnitt er Weißbrotscheiben, nicht zu dick und nicht zu dünn. Er nahm Wurst, Käse, Senf und ein Ei aus dem Kühlschrank. Das Wasser im Teekessel begann zu sieden, und er beeilte sich den Teetopf vorzubereiten, den er benutzte um den Tee drei Minuten ziehen zu lassen. Er wickelte das fertige Ei in ein Geschirrtuch, weil er nichts so sehr haßte wie kalte, weichgekochte Eier. Dann holte er die Zeitung aus dem Briefkasten, wobei er einen gefüllten Müllbeutel mitnahm, um ihn in die Mülltonne zu werfen.
Nachdem er gegessen und Kaffee getrunken hatte, folgte der rituelle Teil. Er goß Tee in ein Teeglas und schlug die Zeitung auf. Ein Jahr zuvor wäre es noch der Moment für die erste Zigarette des Tages gewesen, aber das Rauchen hatte er zehn Monate zuvor aufgegeben. Es lief recht gut. Nur manchmal träumte er davon, und auch in diesem Traum war die Situation immer die gleiche. Er saß an einem runden Tisch, und er war nicht allein. Er nahm die Zigarette aus einer offenen Schachtel, zündete sie an und machte zwei Züge. Wenn er das Kratzen im Hals spürte, wachte er auf, und jedesmal war er enttäuscht, weil er es nicht geschafft hatte. Und jedesmal folgte die Erleichterung darüber, daß es nur ein Traum gewesen war.
In der Wochenendbeilage suchte er zuerst die Seite mit den Kontaktanzeigen. Es hatte angefangen, als die Frau, mit der er zum zweiten Mal verheiratet war, sagte, daß sie ihn nicht mehr lieben würde. Zuerst war er nur ratlos gewesen, und er hatte nicht gewußt, was er tun sollte. Also tat er gar nichts. Die Frau war fünfzehn Jahre jünger als er. Geschieden wurden sie noch nach dem alten Familienrecht, das eigentlich das neue hätte sein sollen, und es dauerte fünfunddreißig Minuten. Wäre die junge Richterin nicht in allen Einzelheiten so genau gewesen, wären sie mit zwanzig Minuten ausgekommen.
Er bereitete die Waschmaschine vor und sortierte die Wäsche. Er benutzte immer noch seine alte „Schwarzenberg“. Als seine Exgattin ausgezogen war, hatte er sich keinen Automaten kaufen wollen, weil man mit dem alten Modell jede Menge Zeit herumbringen konnte. Besser rote Hände vom Wäschewringen als depressiv werden, aber der Blues packte ihn später trotzdem, und dann halfen am Abend manchmal nur noch ein paar Schnäpse und zwei oder drei Biere. Danach hatte er die richtige Bettschwere. Er trank den kalt gewordenen Rest des Tees, während die Waschmaschine kollernd mit seiner Unterwäsche, drei Handtüchern und ein paar Taschentüchern beschäftigt war.
Mit der Zeit wurde er ein brauchbarer Kontaktanzeigen-Analytiker. Von den Anzeigen, in denen ein Mann mit handwerklichen Fähigkeiten und Interesse an Haus und Garten, möglichst NTR und NR, von einer attraktiven Frau ohne Anhang, aber mit Führerschein, gesucht wurde, ließ er tunlichst die Finger. Er dachte sich einen Brieftext aus, an dem er so lange feilte, bis er ihn für perfekt hielt. Er begnügte sich nicht mit zwei, drei lapidaren Sätzen, und er schwelgte auch nicht in Selbstmitleid. Er tilgte nach und nach alles, was zu persönlich klang, alles was auf unbewältigte Probleme hinwies, und alles was zu verbindlich wirkte. Er betonte seine Vorzüge, aber nicht zu sehr, und er verschwieg auch seine Fehler nicht. Seine wirklich problematischen Seiten jedoch behielt er für sich. Er führte Beispiele an, über die jede Frau zwar die Stirn runzelt, mit denen sie jedoch mit Sicherheit gut leben kann. So behauptete er zum Beispiel, daß er keine Ordnung halten könnte, nun ja … Er hatte den Text auf seinem Dienstcomputer gespeichert, damals hatte er keinen eigenen, und je nach Bedarf konnte er zwei oder auch sieben Kopien ausdrucken.
Er erreichte ein Trefferquote von einer Antwort auf vier bis fünf Zuschriften, und die Ergebnisse der Rendezvous waren meist entmutigend. Die Quote stieg erst auf etwa eins zu zwei, als er sich entschloß, die Briefe mit der Hand zu schreiben, und je nach Geist der Annonce kleine Variationen anzubringen. Aber das war sehr aufwendig. Er begann damit, nachdem ein Verhältnis zu Ende war, das etwa ein Jahr gedauert hatte. Es hatte mit einem solchen Computerbrief begonnen, und es war für beide Seiten unbefriedigend geblieben. Die Frauen, die er durch die handgeschriebenen Briefe kennenlernte, waren durchweg angenehmer, und an einen Zufall mochte er nicht glauben. Später gab er selbst eine Annonce auf. Er bekam dreiundsechzig Zuschriften, aber drei viertel davon warf er sofort in den Mülleimer, weil ihre Verfasserinnen im weiteren Umland der Stadt lebten, und er besaß damals kein Auto.
Obwohl er beim Dutzend aufgehört hatte zu zählen, konnte er sich nur an zwei wirklich unangenehme Rendezvous erinnern. Das zweite war ein Alptraum gewesen, dagegen war die Geschichte mit den lüsternen Musketieren bloß Fernsehtheater. Er hatte sich mit einer Dame verabredet, die auf seine eigene Annonce geantwortet hatte, und er hatte sie ausgewählt, weil sich ihr Brief durch ein eigenwilliges Schriftbild und einen sauberen und klaren Stil auszeichnete. Sie gingen in ein Lokal, das sie vorgeschlagen hatte, und wo man sie wie eine unliebsame Verwandte begrüßte. Die Kellner und die junge Frau hinter der Theke warfen sich vielsagende Blicke zu und verzogen gequält die Gesichter. Er registrierte es mit Unbehagen, aber sein Stelldichein schien nichts von alledem zu bemerken. Nachdem man die üblichen Höflichkeiten und die ersten Sachinformationen ausgetauscht hatte, spürte er, daß irgend etwas nicht stimmte, aber noch konnte er nichts damit anfangen. Als sie dazu überging, ihren Exgatten mit ausgesuchten Haßtiraden zu bedenken und sie sich dabei nicht unterbrechen ließ, begann es ihm zu dämmern. Es gelang ihr mit Leichtigkeit, von jedem beliebigen Thema darauf zurückzukommen. Als sie ihm erzählte, daß ihre Großtante, die in einem Pflegeheim gelebt hätte, von „denen, Sie wissen schon …“ zu Tode gebracht worden sei, und daß man auch hinter ihr her sei, weil sie darüber zu viel wisse, begann er zu überlegen, wie er so schnell wie möglich verschwinden könnte. Sie tat ihm leid, aber sie machte es ihm leicht, weil sie jeden Zweifel einfach ignorierte, ein Symptom jener Krankheit, wie er später erfuhr. Als sie sich am Ende intelligent und vernünftig und in völlig normaler Stimmlage mit dem Kellner unterhielt, gab es ihm den Rest. Dann hielten sie ein Taxi an, und nachdem sie eingestiegen war, drückte er dem Fahrer zwanzig Mark in die Hand, schlug die Tür zu und flüchtete zur Straßenbahnhaltestelle.
Für gewöhnlich jedoch verliefen solche Treffen weit weniger spektakulär. Der Platz für das Treffen muß bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Er muß zentral gelegen und von jedem Punkt der Stadt leicht zu erreichen sein. Er sollte sich durch ein bestimmtes Merkmal von anderen Plätzen unterscheiden, das hilft Mißverständnisse zu vermeiden. Ein Brunnen kann ein solches Merkmal sein, oder auch die berühmte Normaluhr, aber auch ein Zeitungskiosk erfüllt diesen Zweck. Nützlich wäre es, wenn der Platz dem Wartenden eine gewisse Anonymität sichert, aber er sollte auch nicht zu groß sein, sonst verliert man sich. Ist er zu belebt, läuft man womöglich aneinander vorbei. Aber das war ihm nie passiert. In seiner Heimatstadt erfüllte der Augustusplatz auf ideale Weise all diese Bedingungen, und abends ab sieben konnte man sie rund um den Mendebrunnen und am Gewandhaus beobachten. Sie gehen nervös auf und ab, manche rauchen die soundsovielte Zigarette, und sie sehen jede Minute auf die Armbanduhr, und zur Kontrolle gleich noch mal auf die Uhr am Krochhaus. Meist sind die Männer zuerst da, und weil er immer viel zu früh kam, konnte er es in aller Ausführlichkeit beobachten. Er mochte es nur nicht, wenn ihn die Damen in ihre eigene Wohnung einluden, auch das kam vor. Man war nicht auf neutralem Boden, und die Damen hatten Heimvorteil. Meist ging dem Treffen ein kurzer Briefwechsel voraus, und man wußte ungefähr, was einem bevorstand. Alter, Größe, Haarfarbe und Statur waren das Mindeste, was man sich mitteilte. Ein Foto konnte hilfreich sein, aber wer hat schon immer ein passendes zur Hand, und wer gibt es schon gern weg, wer weiß an wen? Außerdem fand er es um so spannender, je weniger man voneinander wußte, und das Kribbeln vor dem ersten Treffen allein war Grund genug, es immer wieder zu versuchen.
Wenn es stimmt, daß die ersten dreißig Sekunden einer Bekanntschaft über deren Zukunft entscheiden, waren Kaffee und Kuchen, Wein und Likör in fünfundneunzig Prozent aller Fälle rausgeschmissenes Geld gewesen. Wenn es denn klar war, daß es wieder nicht gefunkt hatte, konnte man immer noch einen netten Abend haben. Man konnte seine Erfahrungen als Single austauschen, zum Beispiel, das ging immer, oder man konnte über Filme, Musik oder Bücher reden. Oder auch nur über die Lieblingsurlaubsziele …
Er schaltete zum zweiten Mal den Waschgang der Maschine ein, beobachtete, wie die Wäschestücke herumwirbelten, nickte zufrieden und schloß den Deckel. Er ließ Wasser in die Wanne laufen, und als die Maschine sich abgeschaltet hatte, wrang er die Wäsche aus, und er warf sie hinein. Dann waren die Socken und die Hemden dran. Und wieder begann die gewohnte Prozedur, ein paar Minuten Vorwäsche, eine halbe Stunde ziehen lassen, dann Hauptwäsche. Das Spülen verursachte die meiste Mühe, damit konnte man ordentlich Zeit schinden. Auf diese Weise konnte man Stunden verbringen.
An einem heißen Nachmittag im Sommer des Jahre ’90 hatte er sehr angenehme Stunden mit einer bezaubernden Witwe verbracht. Er fand es reizend, wie sie über ihren kleinen Sohn sprach, und wie sie verschämt die Augen niederschlug, wenn sie von seinen kleinen Frechheiten erzählte. Sie war neununddreißig, aber man sah ihr weder das Alter noch die Witwenschaft an. Sie trug ein wunderbares Dekolletee zur Schau, und auf ihrer Oberlippe bildeten sich in der Hitze winzige Schweißperlen, und er war hingerissen. Bald aber war es klar, daß es ihr vor allem darum ging, eine neue Familie zu gründen. Behutsam versuchte er, ihr seinen Standpunkt zu erläutern. Ein Mann von Ende vierzig hatte schon mal Familie gehabt, und es waren Kinder da, und sie standen schon auf eigenen Füßen, oder doch beinahe. Wenn er Umgang mit ihnen pflegt, sich um ihre Sorgen und um ihre Entwicklung kümmert, so gut es die Umstände erlauben, und oft ist das nicht leicht, denn da ist noch die Mutter der Kinder, und oft gibt es einen Stiefvater, dann hat er mit dieser Ex-Familie alle Hände voll zu tun. Er sucht eine neue Partnerin, aber keine neue Familie! Wenn er das eine ohne das andere nicht haben konnte, dann war es in Ordnung. Wer das eine will, muß das andere mögen, und das Leben hat nur zwei Tage. Und wer weiß, vielleicht geht es ja gut. Er hielt ihr den kleinen Vortrag, und er fühlte sich wie ein Therapeut, und es tat ihm leid, denn er hatte den Eindruck, daß sie seine Sympathie erwiderte. Ein paar Tage später erhielt er einen Brief von ihr. Es täte ihr leid, aber eigentlich … und so weiter, aber damit konnte er leben.
Er dachte an die Fahranfängerin, die ihm angeboten hatte, ihn mit ihrem „Trabant“ nach Hause zu fahren. Sie brachte ihn und sich auf dem Heimweg beinahe um, als sie in einer Kurve zu weit nach links auf die Straßenbahnschienen geriet, und die entgegenkommende Bahn laut klingelnd mit schrill kreischenden Bremsen gerade noch zum stehen kam. Ihm wurde speiübel. Kreidebleich, mit weichen Knien, war er ausgestiegen, und er war die restlichen fünf Kilometer zu Fuß gegangen. Unterwegs hatte er im „Böttgereck“ haltgemacht, es gab „Nordhäuser Doppelkorn“, und nachts in seinem Bett fuhr er Karussell. Und da war jene liebenswerte, aber ein wenig schlicht gestrickte junge Frau mit dem verhaltensgestörten zwölfjährigen Sohn gewesen, der sich während der ersten Einladung zum Kaffeetrinken immerfort zu Wort meldete, indem er laut schreiend Einwortsätze hervorstieß. Beim zweiten Mal, er hatte sie in den Zoo eingeladen, rannte der Junge ungeduldig von Gehege zu Gehege, von Käfig zu Käfig, und er war nur durch Eiscreme und größere Mengen Cola, es durfte nur die mit dem hohen Zuckergehalt sein, einigermaßen ruhigzustellen. Einen derartig kurzen Zoobesuch hatte er noch nie erlebt, und dabei war es auch geblieben. Und er dachte, ein bißchen wehmütig, an die attraktive Hobbygärtnerin, die ihren Schrebergarten ganz in der Nähe seiner Wohnung hatte. Sie war nett und selbstbewußt, und sie war intelligent, aber es stellte sich heraus, daß sie seine erste Frau gekannt hatte. Sie waren Kolleginnen gewesen, und sie hatte einen großen Teil der Ereignisse um den Scherbenhaufen, der zur Scheidung geführt hatte, mitbekommen. Sie wollte ihn gern wiedersehen, aber sie räumte ihm Bedenkzeit ein, und sie gab ihm ihre Telefonnummer. Aber wegen des Scherbenhaufens und der Scham, die sich damit verband, und vielleicht auch wegen ihrer Attraktivität und ihrer Intelligenz, die sie selbstbewußt zur Schau trug, hatte er sich nie bei ihr gemeldet. „Scheiße“, sagte er laut, und noch einmal, „Scheiße!“.
Richtig ärgerlich war es, wenn eine vorsichtig begonnene Beziehung, an der bis dahin nichts auszusetzen war, mit fadenscheinigen Begründungen abgebrochen wurde. Die Damen gingen dabei zu Werke wie die allerletzten Trampel, und er fühlte sich ausgenutzt und hintergangen. Es war ihm dreimal passiert, und jedesmal hatte er ernsthaft nachgedacht, ob er damit aufhören sollte. Sobald er jedoch wieder eine Wochenendausgabe seiner Zeitung in der Hand hielt, vergaß er die Fehlschläge, und was zählte, waren die passenden Anzeigen „Sie 43/1,59 sucht …“.
Zeit für die Hauptwäsche, dachte er, und dann wird gespült. Er spürte es wieder im Kreuz, und bei dem Wetter war das kein Wunder. Damit er das Bücken beim Spülen und Wringen an der Wanne einigermaßen überstand, nahm er eine Schmerztablette, und er legte sich ein wenig aufs Bett, wobei er sich das Heizkissen unters Kreuz stopfte. Als er spürte, daß er hinüberzudämmern begann, wünschte er sich, von der antiken Stadt an der Meeresbucht zu träumen. Aber daraus wurde nichts. Der Regen hatte wieder zugenommen, und das Geräusch an der Fensterscheibe hinderte ihn am Einschlafen. Er erinnerte sich daran, daß es früher kein besseres Schlafmittel als dieses Geräusch gegeben hatte, und er bedauerte, daß es nicht mehr funktionierte. Selbst wenn eine herrliche Hochwetterlage herrschte und an Regen überhaupt nicht zu denken war, brauchte er sich nur vorzustellen, es regnet und er schaut durch ein kleines Fenster hinaus in den Regen, und schon schlief er ein.
Es gab nur eine Art von Regen, die er nicht mochte. Es war der Regen, vermischt mit Schnee oder Hagel, den einem ein kräftiger Wind bei höchstens fünf Grad Celsius ins Gesicht blies. Das tat weh. Wenn man jedoch zu Hause in seinem behaglichen Zimmer saß, ein Glas Rotwein in der einen Hand und ein Buch in der anderen, und es war gemütlich warm, und das Radio spielte ganz leise, war der auch nicht schlecht. Am liebsten war ihm der feine, stetige Landregen im Sommer bei Windstille, sinnierte er. Wenn man an einem Gewässer saß, in einem Boot auf einem See, und man war irgendwie, vielleicht mit einer guten Wetterjacke, vor der Nässe geschützt, konnte man das Geräusch des Regens auf der Wasseroberfläche als gleichmäßiges leises Zischen hören, und dann gab es nichts besseres als den Regen zu beobachten, und man konnte die Angel Angel sein lassen und die Fische Fische, und alles andere auch. Auch den Herbstregen mochte er. Er ging gern abends spazieren, wenn die Bäume schon ihr Laub verloren hatten, und sich die vor Nässe schwarz glänzenden Zweige im Gegenschein einer Straßenlaterne scheinbar zu kugelförmigen Gebilden formierten.
Die Wäsche war fertig, und beim Spülen nahm er sich Zeit. Während Wasser in die Wanne lief, schlurfte er durch seine Wohnung, stellte hier ein Buch gerade, sammelte dort ein Papierschnipsel auf und räumte da ein leeres Glas vom Tisch. Wenn die Wäsche im frischen Spülwasser lag, stand er erst mal am Fenster und beobachtete den Regen. Nachdem er die Wäsche geschleudert hatte, hängte er sie auf den Trockner über der Badewanne, räumte die Utensilien weg und wischte den Fußboden auf. Er wärmte sich einen Rest Nudelsuppe. Die Nudeln schmeckten schon ein wenig pappig, aber er hatte nichts anderes.
Nachdem er das Geschirr gespült hatte, schaute er zum Fenster hinaus. Ein paar Leute kamen mit ihren Einkäufen vom Discounter nach Hause. Sie gingen gebückt, und sie suchten sich mit Regenschirmen zu schützen oder trugen Regenmäntel. Die Kinder, die sonst lärmend zwischen den Blöcken spielten, waren daheim geblieben. Die Postbotin kam mit ihrem gelben, schwer beladenen Fahrrad um die Ecke. Ihr tritt war ungelenk und müde, und sie trug eine gelbe Regenjacke mit Kapuze. Er wartete, bis sie sich seinem Hauseingang genähert hatte. Dann griff er nach dem Wohnungsschlüssel und ging hinunter. Die Postbotin hatte gerade das Haus wieder verlassen, er hörte auf der ersten Treppe noch die Haustür zuschlagen, als er unten war. Er öffnete seinen Briefkasten, und entnahm ihm zwei Briefe. Einer machte einen offiziellen und amtlichen Eindruck. Er hatte seine Brille vergessen, und er konnte den Absender nicht lesen. Aber das Wappen seiner Heimatstadt als Stempel auf dem Umschlag konnte er erkennen, und er runzelte die Stirn. Aber der andere, der andere war Rosa, und als er ihn an die Nase hielt, nahm er einen leichten Duft von Kölnisch Wasser wahr …
* * *
© Bernd Mai Leipzig 1993, 2002 & 2013
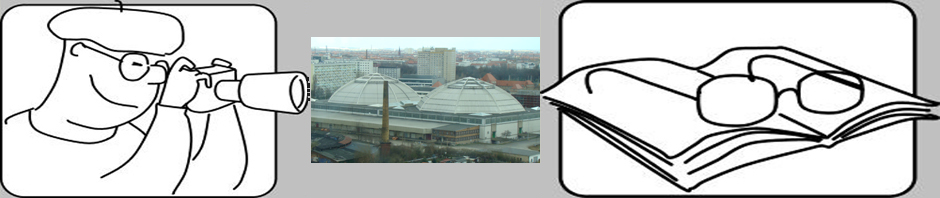
Die alten Maschienen haben einfach mehr Ausdauer, bei den Neuen heißt es gleich: da ist nichtsmehr zu achen, also das Nächste bitte!
Deine Geschichten sind auch interessant, Arbeit-Unterhaltung und Muse gehören auch zusammen (°.°)
lieber Gruß Maria