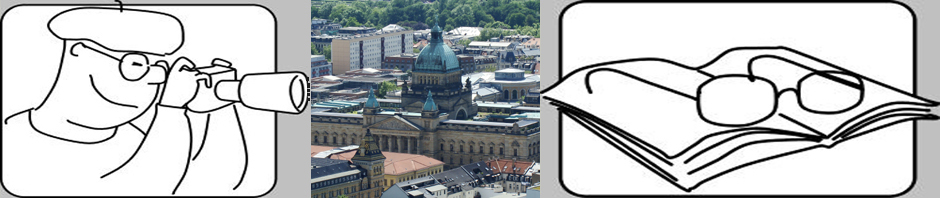Wenn man von der Leihbücherei aus hundert Meter weiter in Richtung Stadtzentrum ging, fand man auf der selben Straßenseite ein privates Buchantiquariat, heute würde man wahrscheinlich Secondhand-Buch-Shop sagen, damals hieß das Modernes Antiquariat. Ich kann aber nicht beschwören, daß dort nicht auch wirklich antiquarische Bücher gehandelt wurden. Es war ein Laden des berühmten Antiquariats Goedecke, das in Leipzig mehrere Filialen unterhielt. Dort habe ich als junger Bursche in den Sechzigern und den frühen Siebzigern so manches lang gesuchte Buch sehr billig erwerben können. Ich erinnere mich an mehrere Lem-Ausgaben und diverse Science-fiction-Bücher anderer Autoren, die wir damals noch „Utopische“ nannten. Außerdem Heinrich Manns „Henry Quatre“, einige Krimis vom Verlag Volk und Welt, Dürrenmatt, Böll, Lenz und andere Autoren, alles Raritäten wegen der geringen Auflagenhöhe – VOLK UND WELT mußte die Lizenzen in harten Devisen bezahlen – und alle außerordentlich begehrt. Es war eine Lust, in dem engen und altmodischen Laden zwischen den Regalen herumzustöbern! Es stimmt mich traurig, daß so weniges von damals die großen und kleinen Katastrophen der Jahre in meinem Regal überdauert hat. Nun gut, inzwischen muß ich mir wieder Gedanken machen, wo ich Platz für neue Bücher in meiner Wohnung finde. Nur – es sind nicht mehr die von damals.
Sie kosteten – wie gesagt – Spottpreise, kein Vergleich zu den heutigen, und ich habe mich immer gefragt, wie der Besitzer auf seinen Profit kam. Eines Tages jedoch, buchstäblich über Nacht, war das Geschäft geschlossen. Wenige Tage später konnte ich beobachten, wie einige auffallend korrekt gekleidete junge Männer den Laden ausräumten, den Buchbestand in einen Lastwagen verluden und abtransportierten.
Von jener Stelle bis zur Kinderbücherei ist es nicht mehr weit. Man geht weiter stadteinwärts bis zum Leuschnerplatz, biegt dort nach rechts ab, und wenn man vor dem – jetzt leider geschlossenen – Ring-Café steht, ist man an der richtigen Adresse. Rechts neben dem Café, in einem Durchgang, fände man den Eingang, wenn es die Bibliothek heute noch gäbe. Das riesige, in der Gewandhausvariante des Zuckerbäckerstils erbaute Gebäude war damals unter dem Namen „Ring-Bebauung“ bekannt. Er rührte daher, daß der gesamte Promenadenring in dieser Manier bebaut werden sollte. Zum Glück ist uns das erspart geblieben.
Mancher Leser wird die Stirn runzeln. Gab es in den fünfziger Jahren nichts Bewegenderes als Bücher und Bibliotheken, wird er sich fragen, das Land wurde aufgebaut, wird er sagen, und er kommt uns mit irgendwelchen privaten Buchverleihern und kriminellen Antiquaren. Vielleicht will er uns noch erzählen, wie das Wetter war!
Na schön, im Westen waren sie damit schon fertig, mit dem Aufbau, und wie das Wetter war in jenen Tagen, weiß ich nicht mehr. Ich sollte es wissen, meint Mister Hemingstein, aber Mister Hemingstein ist lange tot. Man ist 365 Tage lang zwölf Jahre alt, und man kann nicht 365 Tage lang lauter erstaunliche und bemerkenswerte Abenteuer erleben, an deren Stimmungen man sich sein Leben lang erinnert. Die Schultage gleichen sich alle wie die Tage in einem Büro oder am Fließband. Es sind immer die selben Lehrer und die selben Mitschüler, und immer geht man den selben Weg zur Schule, und auf den Pausenbroten ist immer der gleiche Belag, und zum Abendessen gibt es auch immer das Gleiche. In den Ferien ist das anders. In den Ferien sause ich auf meinem weinroten MIFA-Tourenrad die Grunerstraße hinunter, die als einzige weit und breit durchgehend asphaltiert war, und der Wind jenes Sommers weht mir heiß wie aus dem Fön um die Ohren und er fängt sich in meinem offenen Hemd, und wir quälen uns auf der Merseburger Landstraße die Steigung zum Sandberg in Rückmarsdorf hinauf, wenn wir zum Schnorcheln an den Kanal fahren, und die weißen Wölkchen am blauen Himmel sind trügerisch, denn eine Stunde später zieht der Regen heran. Am Kanal gibt es keine Möglichkeit zum Unterstellen, und der Sommerregen fällt zischend auf die Wasseroberfläche, und wir versuchen uns notdürftig mit unseren Handtüchern vor der Nässe von oben zu schützen, vergebens. Aber die Ferien meiner Kindheit sind nicht das Thema. Freilich – die Sommer waren noch Sommer, im Winter fiel noch richtiger Schnee, man konnte noch rodeln gehen, und im Hof konnte man einen Schneemann bauen. Wetter machte auf mich wenig Eindruck. Wenn es schön war, und schön war ein weiter Begriff, dann spielten wir auf der Straße oder auf unserem Hof, oder auf einem Hof in der Nachbarschaft. Wir wohnten in der Hohen Straße, in der Nummer 35, auf dem Abschnitt zwischen Bernhard-Göring- und Karl-Liebknecht-Straße. Die Nummer 51, in der um 1925 der junge Doktorand Kästner einige Zeit gewohnt hatte, befand sich außerhalb unseres Quartiers, weiter westlich in Richtung „Musikerviertel“, wo die Häuser begannen, einen diskreten bildungsbürgerlichen Charme auszustrahlen. Die Straße war – wie der gesamte Stadtteil zwischen Peterssteinweg und Connewitzer Kreuz – zur Gründerzeit entstanden. Die meist repräsentativen Vorderhäuser gruppierten sich mit ihren plebejischen Seitenflügeln und Hinterhäusern um Höfe, die ganz oder teilweise gepflastert oder asphaltiert waren. In den Seitenflügeln und Hinterhäusern befanden sich Garagen, Werkstätten oder kleine Fabriken. In den fünfziger Jahren wurden sie fast alle noch privat betrieben. Zwischen den Häusern waren Lücken, die der Bombenkrieg gerissen hatte, und in manchen der Lücken, auf den sogenannten Trümmergrundstücken, standen noch erdgeschoßhohe Ruinen. Aber ich will nicht vorgreifen. Die Höfe der Nachbarschaft waren oft für uns tabu. Manchmal wegen der laufenden Produktion, manchmal aber auch wegen einer ganz besonderen Spezies von Hausbewohnern – den alten Weibern. Sie duldeten es nicht, wenn fremde Kinder auf „ihrem“ Hof spielten. Besonders widerlich war die alte Krausen aus dem Seitenflügel der Nummer 36, gleich gegenüber. Der Hof war asphaltiert, und er war groß genug, daß man wunderbar Roller oder Rad fahren konnte. Der große Bruder meines Freundes brachte mir dort auf einem alten Damenrad das Radfahren bei. Die Alte wohnte im Erdgeschoß, und sobald sie uns bemerkte, riß sie das Fenster auf und keifte los. Ihre Stimme war so fürchterlich durchdringend, wie ich es niemals wieder in meinem Leben gehört habe. Selbst als Soldat nicht. Ich hatte Angst vor ihr, ich denke, wir alle hatten Angst vor ihr, und ich habe sie mit der ganzen Kraft meiner kindlichen Seele gehaßt. Nachdem jemand mit Kreide „Krausen is doof“ auf eines der Garagentore geschrieben hatte, traute ich mich gar nicht mehr dorthin, außer ich wußte genau, daß sie nicht zu hause war. Sie lebte allein, und sie zog ihre Enkelin auf. Die Enkelin war ein hübsches Mädchen, und sie war wohl etwas älter als unsere älteren Brüder und ihre Freunde. Irgendwann fing sie an, sich mit Männern abzugeben. Das waren keine gewöhnlichen jungen Burschen, wie wir sie in der Nachbarschaft hatten, fröhlich und jederzeit zu Scherzen und wichtigtuerischen Gesprächen mit uns Jüngeren aufgelegt, während sie an ihren Motorrädern bastelten. Sie ging mit reifen und distinguierten Herren aus, und irgendwann war sie schwanger und die distinguierten Herren waren alle weg. Das sagten jedenfalls unsere Mütter. Ich schäme mich heute ein wenig, daß ich damals eine gehörige Portion Schadenfreude empfand – aber die Scham hält sich in Grenzen.
Forts. folgt