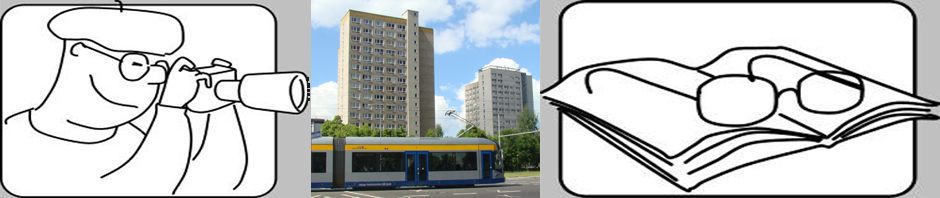Die Zeit zwischen 1945 und 1955 war eine große Gleichmacherin. Mir war natürlich bewußt, daß die Menschen, auch meine Freunde und Klassenkameraden, in Bildung, Einkommen, Herkunft und Neigung verschieden waren. Aber aus selbständigen Handwerkern und Händlern, Intellektuellen und Beamtem wurden nach den großen Fluchtbewegungen und in der Umschichtung der Zeit Proletarier wie wir, und die fähigen Ingenieure gingen entweder gleich in den Westen, oder sie stiegen erst durch ihre Einzelverträge wieder in der Hirarchie nach oben, als die Abwanderung zur Bedrohung für die Wirtschaft wurde. Wer im Osten des Reiches ein Haus, ein Grundstück oder eine Bauernwirtschaft mit ein paar Feldern, Wiesen und Kühen besessen hatte, ging in die Schwerindustrie, die Chemie oder in den Bergbau, und er wurde zum Mieter einer miefigen Hinterhauswohnung ohne Bad und Innentoilette. Es sei denn, er profitierte von der Bodenreform und wurde Neubauer. Egal, wo man einzukaufen pflegte, im Konsum-Laden, im HO-Laden oder beim privaten Kaufmann, es gab überall die gleichen Produkte zu kaufen, wenn es sie denn zu kaufen gab, und sie kosteten überall das selbe. Unsere Väter tranken das gleiche Bier und den gleichen Verschnitt-Weinbrand und wir Kinder die gleiche gelbe oder rote Limonade, manchmal war sie auch farblos und schmeckte einfach süß-sauer. Die Einführung eines Getränkes, das sich Vita Cola nannte, kam einer Revolution gleich. Sein vergleichsweise geringer Zuckergehalt, heute ein zugkräftiges Werbeargument, war damals vermutlich eher auf die knappen Ressourcen zurückzuführen. Wir besuchten keinen Kindergarten, und unsere Mütter waren nicht berufstätig, es sei denn, sie waren alleinstehend. Trotzdem wuchsen wir alle auf der Straße auf. Unsere Mütter hatten bei drei bis fünf Kindern alle Hände voll mit dem Haushalt zu tun. Es gab keine Waschmaschinen und keine elektrischen Kühlschränke. Ein alter Siemens-Staubsauger im Haushalt meines Freundes D. weckte in mir Erstaunen und Unverständnis. War große Wäsche angesagt, dann hieß das „Waschfest“, und ein solches Waschfest konnte mit allem Drum und Dran ein paar Tage dauern. So hatten sie alle Hände voll zu tun, und wir waren meist uns selbst überlassen. Beaufsichtigt wurden wir, solange es nötig war, von unseren älteren Geschwistern, oder von den Geschwistern unserer Gefährten, oder von irgendwelchen anderen älteren Kindern aus der Nachbarschaft. Die nach Altersstufen sortierten Cliquen und die Differenzierung nach „Studierten“ und „Nichtstudierten“ kamen erst später auf, und das Wir-Gefühl war für mich etwas ganz Selbstverständliches.
Natürlich gab es Ausnahmen. Im Nachbarhaus, der Nummer 29 – Vorderhaus, wohnten zwei Mädchen, eineiige Zwillinge, die mit mir gemeinsam zehn Jahre lang die selbe Klasse besuchten. Sie hießen I. und B., und ihr Vater betrieb eine selbständige Druckerei. Sie waren zwei nette, durchschnittliche Kinder ohne Hang zu Absonderlichkeiten. Sie trugen immer genau die gleiche adrette Kleidung, und ihre Haare waren stets auf die selbe Weise frisiert. Sie benutzten die gleichen Ranzen, Turnbeutel und Federmappen, und niemand, außer ihrer Mutter, konnte sie auseinanderhalten. Sie taten immer alles gemeinsam, aber sie spielten selten auf der Straße, denn sie besaßen eine Kinderstube. Lange hatte ich diesen Ausdruck für etwas rein Symboliches gehalten, das im Gezeter der alten Weiber manchmal eine Rolle spielte. Als ich jedoch gemeinsam mit den Zwillingen das erste Mal in ihrem geräumigen und kuscheligen Kinderzimmer Hausaufgaben erledigte, wurde mir der Unterschied bewußt. Unser Kinderzimmer dagegen war mit zwei Betten, einem Kleiderschrank, einem Tisch und einem Kachelofen fast völlig ausgefüllt, und mein Bücherregal, eine Eigenkonstruktion meines Vaters, war über dem Tisch an der Wand befestigt. Die Möbel waren alt und eher zufällig zusammengestoppelt, und alles war auf Zweckmäßigkeit ausgelegt. Platz zum Spielen gab es wenig. Die Zwillinge genossen eine durch und durch (klein-)bürgerliche Erziehung, und ihr Tagesablauf war streng geregelt. Wenn ich bei ihnen klingelte, um sie zum Spielen abzuholen, hieß es meist, sie müßten jetzt lernen. Deshalb ließ ich das irgendwann bleiben. Als wir in der achten oder neunten Klasse waren, erlitt eine von ihnen einen Nervenzusammenbruch, und sie nahm viele Wochen lang nicht am Unterricht teil. Anläßlich einer Klassenfete während dieser Zeit hätte ich mit der anderen beinahe etwas angefangen, aber es wurde nichts daraus. Wer weiß, was aus mir geworden wäre …