Autor unbekannt
(aus dem Amerikanischen von Bernd Mai)
Ich kam an der Adresse, die mir Vera durchgesagt hatte, an und hupte. Nachdem ich ein paar Minuten gewartet hatte, hupte ich wieder. Da es die letzte Fahrt in meiner Schicht sein würde, dachte ich darüber nach, einfach wegzufahren. Stattdessen parkte ich das Taxi, ging zur Tür und klopfte an.
„Nur eine Minute“, antwortete eine gebrechliche, ältere Stimme. Ich konnte hören, wie etwas über den Boden geschleift wurde.
Nach einer langen Pause öffnete sich die Tür. Eine kleine Frau in den Neunzigern stand vor mir. Sie trug ein bedrucktes Kleid und ein altmodisches Hütchen mit einem Schleier, wie jemand aus einem Film aus den 1950er Jahren. Neben ihr stand ein kleiner Nylonkoffer. Die Wohnung sah aus, als hätte jahrelang niemand darin gelebt. Alle Möbel waren mit Laken bedeckt.
Es gab keine Uhren an den Wänden, keine Schnickschnack oder Utensilien in den Regalen. In einer Ecke stand ein Karton, der mit Gläsern und Porzellannippes gefüllt war. Meine Mutter hätte jedes einzelne Stück in Zeitungspapier eingewickelt, egal, welcher Bestimmung es zugeführt werden sollte. Aber vielleicht hat es in diesem Hause keine Zeitung gegeben.
„Würden Sie meine Tasche zum Auto tragen?“ fragte sie. Ich brachte den Koffer zum Wagen und kehrte dann zurück, um der Frau zu helfen. Sie nahm meinen Arm und wir gingen langsam zum Bordstein. Sie dankte mir immer wieder für meine Freundlichkeit.
„Das ist doch selbstverständlich“, sagte ich zu ihr. „Ich versuche nur, meine Fahrgäste so zu behandeln, wie ich möchte, dass meine Mutter behandelt wird.“
„Du bist ein guter Junge“, sagte sie. Als wir in das Taxi stiegen, gab sie mir eine Adresse und fragte dann: „Könnten wir durch die Innenstadt fahren?“
„Das ist aber nicht der kürzeste Weg“, antwortete ich zögernd.
„Oh, das macht mir nichts aus“, sagte sie. „Ich habe es nicht eilig. Ich bin auf dem Weg ins Hospiz.
Ich schaute in den Rückspiegel. Ihre Augen funkelten.
„Ich habe keine Familie mehr“, fuhr sie mit leiser Stimme fort. „Der Arzt sagt, ich habe nicht mehr viel Zeit.“ Ich griff schweigend hinüber und schaltete das Taxameter aus.
„Welchen Weg soll ich nehmen?“ fragte ich. Sie antwortete mit einer vagen Handbewegung.
Die nächsten zwei Stunden fuhren wir durch die Stadt. Sie zeigte mir das Gebäude, in dem sie einst als Fahrstuhlführerin gearbeitet hatte. Wir fuhren durch das Viertel, in dem sie und ihr Mann gelebt hatten, als sie frisch verheiratet waren. Sie ließ mich vor einem Möbellager halten, das einst ein Ballsaal gewesen war, in dem sie als Mädchen getanzt hatte.
Manchmal bat sie mich, vor einem bestimmten Gebäude oder einer bestimmten Ecke langsamer zu werden. Dann schirmte sie mit der flachen Hand die Augen gegen die Lichtreflexe ab, starrte in die Dunkelheit und sagte nichts.
Als der erste Anflug von Sonne den Horizont rötete, sagte sie plötzlich: „Ich bin müde. Bringen wir es hinter uns.“
Wir fuhren schweigend zu der Adresse, die sie mir gegeben hatte. Es war ein niedriges Gebäude mit einer Auffahrt, die unter einem Portikus verlief. Sobald wir vorfuhren, kamen eilig zwei Pfleger zum Taxi gelaufen. Sie wirkten besorgt und entschlossen, und sie beobachteten aufmerksam jede ihrer Bewegungen. Sie müssen sie erwartet haben. Ich öffnete den Kofferraum und brachte den kleinen Koffer zur Tür. Die Frau saß bereits im Rollstuhl.
„Wie viel schulde ich dir?“ fragte sie und griff in ihre Handtasche.
„Nichts“, sagte ich
„Du musst deinen Lebensunterhalt verdienen“, antwortete sie.
„Es gibt noch andere Passagiere.“ Noch während ich das sagte, und ohne nachzudenken, bückte ich mich und umarmte sie. Sie hielt mich fest.
„Du hast einer alten Frau einen kleinen Moment der Freude geschenkt“, sagte sie leise, ihr Mund war dicht an meinem Ohr. „Vielen Dank.“
Ich drückte ihre Hand, drehte mich um und ging in das trübe Morgenlicht. Hinter mir fiel fast geräuschlos die große gläserne Eingangstür ins Schloß.
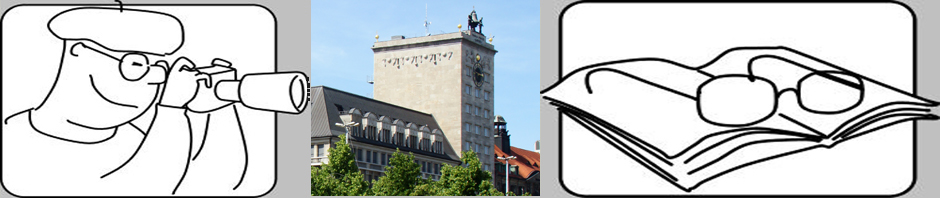
Eine emotionale Geschichte. Aus eigener Erfahrung im ambulanten Hospizdienst muss ich allerdings sagen, dass die Realität anders aussieht. Der Beginn des Aufenthaltes im stationären Hospiz beginnt erst, wenn all das Beschriebene nicht mehr möglich , bzw nicht mehr wichtig für die Patienten (oder Gäste wie sie oft genannt werden) ist. Aber vielleicht ist das „im Amerikanischen“ auch anders.
Vielen Dank fürs Interesse.
In Amerika ist manches anders. Klugscheißer nennt man dort ’smartass‘.
Ein schöner Beitrag zum Thema Selbstlosigkeit. Nicht immer ist Geld das wichtigste im Leben. Ein Lächeln, eine Geste, ein netter Gruß, eine kleine Hilfe ist viel mehr wert als der schnöde Mammon.