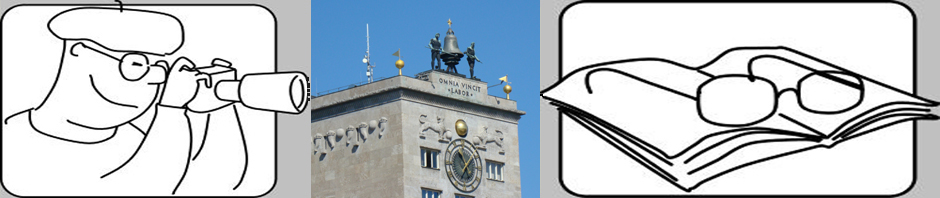Am liebsten spielten wir auf der Zweiunddreißig. So nannten wir ein Trümmergrundstück, die Reste des Hauses Nummer 32, auf dem sich die Jugend der Straße zu treffen pflegte, bis auch dieses eingeebnet wurde. Wir bauten aus den herumliegenden alten Ziegeln kleine Hütten – unsere Buden. In solch einer Bude habe ich zum ersten Mal ein nacktes Mädchen gesehen. Sie war älter als wir, und wir kannten sie nicht. Sie suchte sich ein paar kleine Jungs auf den Höfen zusammen, und wir mußten im Schutz der Bude verschiedene merkwürdige Dinge mit ihr anstellen. Im allgemeinen jedoch war es in solch einer Bude immer sehr behaglich.
Die Großen legten irgendwann den schuttübersäten Innenhof frei, befestigten die Ränder des Trümmerhaufens zum Haus hin mit alten Ziegeln, und malten mit weißer Farbe an die Wände der unversehrten Nachbarhäuser die Fußballtore. Im Winter rodelten wir dort. Auch als Festung war sie hervorragend geeignet. Die straßenwärtigen Mauern standen teilweise noch bis zur Höhe der Erdgeschoßdecke. Nur in der Mitte, wo die Haustür gewesen war, führte ein schmaler Pfad auf den Trümmerberg, und der ließ sich zum Tauch´schen von zwei, drei beherzten Jungen leicht verteidigen. Da wir es „Tauchschorrn“ aussprachen, wobei wir die erste Silbe betonten und die zweite verschliffen, blieb uns die Herkunft des Wortes vom Namen der Stadt Taucha verborgen. Es war ein Kostümfest für Kinder, wobei das Wort Fest nicht genau den Kern der Sache trifft. Es fand alljährlich im Herbst Ende September oder Anfang Oktober statt, und seine Herkunft erklärt sich aus der Rivalität der Städte Taucha und Leipzig im Mittelalter, die zu dieser Zeit noch etwa gleich groß waren. Heute ist Taucha ein Vorort im Nordosten von Leipzig, und kürzlich hätten wir es um ein Haar eingemeindet. Wir verkleideten uns vor allem als Indianer und Trapper, das Wort Cowboy tauchte erst später in der Umgangssprache auf, und im Papierwarenladen der Schwestern Petermann, gleich um die Ecke in der Karl-Liebknecht-Straße, gab es Knallerbsen und Schminke, Indianerstutze und „Trapperhüte“ aus Papier zu kaufen. Wer beschreibt mein Erstaunen, als ich später Abbildungen sah, auf denen Trapper mit ihren typischen Pelzmützen dargestellt waren! Dieser Laden und die ältlichen Schwestern waren in unserer Gegend eine Institution. Solange es sie gab, habe ich nie ein Schulheft, einen Malblock oder einen Bleistift woanders gekauft.
Ein zünftiges „Indianerrot“ stellten wir aus zerstampften Ziegeln und Wasser selbst her, und wir schmierten es uns fachmännisch gegenseitig ins Gesicht. Alte Ziegelbrocken lagen genügend umher, und man konnte sie auch gut als Wurfgeschosse benutzen, wenn die Kinder aus des Siddsche – gemeint war die Sidonienstraße – kamen, um denen aus der Hohen ihre alljährliche Abreibung zu verpassen. Wie diese Prügeleien ausgingen, weiß ich nicht, ich war noch zu klein. Später nahm es zivilisiertere Formen an, und irgendwann verschwand Tauch´schen ganz. Auch Wiederbelebungsversuche konnten daran nichts ändern.
Unsere großen Geschwister ängstigten uns mit schauerlichen Erzählungen über die Untaten der Siddsche, und wir Kleinen versteckten uns, ängstlich und neugierig zugleich, in den Hausfluren, wenn es hieß: „De Siddsche gommd!“. Irgendwann, als ich älter geworden war, begann ich zu glauben, daß unsere älteren Geschwister die einschlägigen Einzelheiten eher aus Karl-May-Romanen entliehen hatten. Als ich längst erwachsen war, erfuhr ich aus sicherer Quelle, daß sie keineswegs geflunkert hatten. Die alljährlich wiederkehrenden Keilereien zwischen den Kindern verschiedener Straßen nahmen manchmal den Charakter von Bandenkriegen an. Einzelgänger wurden gefangen und verschleppt, man ging besser nicht allein durch feindliches Gebiet. Man fesselte sie, brachte sie in ein Versteck, und es soll zu veritablen Folterungen gekommen sein. Wenn man bedenkt, daß der Krieg 1952 erst seit sieben Jahren vorüber war, und daß das Land in weiten Teilen noch immer zerstört war, und daß viele der damals Acht- bis Dreizehnjährigen niemals ihre Väter kennenlernen würden, und daß ein großer Teil der Bevölkerung Haus und Hof und Heimat und damit seine Wurzeln verloren hatte, war das alles nicht verwunderlich. Die Väter, die nach Hause zurückgekehrt waren, waren mit sich selbst und ihren emanzipierten Ehefrauen überfordert, und die autoritären Erziehungsmethoden der vergangenen Jahrzehnte begannen sich unmöglich zu machen. Man erfand damals den Begriff der Schlüsselkinder, und letztlich hing uns allen der Schlüssel zum Zuhause an irgendeinem Bindfaden um den Hals.
Und wenn wir schon mal bei Karl May sind, sind wir auch wieder beim Thema, verlieren wir ruhig ein paar Worte über ihn. In jenen Jahren waren seine „Werke“ hierzulande nicht opportun. Seine Romane wurden nicht gedruckt, und seine Existenz wurde geflissentlich übergangen, bis es irgendwann wenigstens teilweise zu einer Rehabilitation kam. Ich weiß nicht, was die Kulturpolitiker zu dieser Haltung veranlaßt hat, aber für mich steht außer Zweifel, daß es sich neben ideologischen Bedenken auch um wirtschaftliche Gründe gehandelt haben muß. Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings, daß das Indianer- oder Karl-May-Museum in Radebeul niemals in seiner Existenz bedroht war, jedenfalls nicht bis zur Wende, und dann fällt mir noch ein, daß ich als Junge ein Groschenheft kaufte, in dem ein Auszug aus einem der Kara-Ben-Nemsi-Romane abgedruckt war. Damals machten die zerlesenen Bücher mit den nachgedunkelten Einbänden unter den Großen die Runde. Aus irgendwelchen Gründen bekam ich das erste Exemplar eines Karl-May-Romans erst in die Hände, als ich bereits achtzehn Jahre alt war. Ich kam nicht weiter als bis zur elften Seite, und dann hatte ich es satt und ich gab es auf. Der „herrliche Spinner aus Radebeul“ war mir verleidet, ein für alle mal.
Forts. folgt